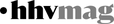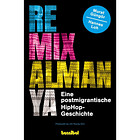»Ich sage Rap, du sagst Sprechgesang«, rappte Tuareg auf dem 1995 erschienenen Album »Die Organisation« der Rap-Supergroup Blitz Mob. Auch wenn die Zeile seinerzeit wohl in erster Linie gegen Die Fantastischen 4 gerichtet war: Der STF-Hype Man bezog damit Stellung gegen eine Strömung, die Jahre später, heute, als Weißwaschung und Almanisierung von Hip-Hop in Deutschland identifiziert wird. Genau das sei nämlich geschehen – sagen die Autoren und ehemaligen Rapper Murat Güngör und Hannes Loh. Und erläutern dies ausführlich in ihrem neuen Buch »Remix Almanya. Eine postmigrantische HipHop-Geschichte«.
Der Ansatz von Güngör und Loh – die übrigens von Uh-Young Kim unterstützt wurden, einem Journalisten, der als »Produzent« des Buchs vorgestellt wird – entspricht dabei ein Stück weit der von Chuck D mitproduzierten Dokureihe »Fight The Power – Wie Hip-Hop die Welt veränderte«. Will heißen: Ihre Interpretation der Szene-Chronologie wird durch soziale, gesellschaftspolitische und migrationsgeschichtliche Eckdaten kontextualisiert, weswegen Helmut Kohl, Thilo Sarazzin oder der 1962 nach Köln emigrierte Musiker Metin Türkoz für dieses Buch deutlich bedeutsamer sind als Deichkind, DCS oder Dendemann.
Remix der deutschen Rap-Chronologie
Die geradlinige Erfolgsstory von Hip-Hop in Deutschland, die ausgehend von einem Randgruppen-Phänomen in einer mittelständischen weißen »neuen deutschen Reimgeneration« mündete und schließlich in Deutschrap kulminierte, wurde zuletzt durch Issa Franke und seinem Buch »Hip Hop – die vergessene Generation Westberlins« ins Wanken gebracht. Auch »Remix Almanya. Eine postmigrantische HipHop-Geschichte« hat das Zeug zur ikonoklastischen Lektüre. Ihr sogenannter Remix der deutschen Rap-Chronologie konzentriert sich auf deren Brüche und Verästelungen, die sich stets am jeweils vorherrschenden politischen Klima abzeichneten. Daher hangelt sich ihr Szene-Sezieren auch nicht an Styles, Skills und der vielbeschworenen Realness entlang, sondern an den soziokulturellen Dynamiken, die das beförderten, was heute den Zeitgeist bestimmt: Hip-Hop als postmigrantisches Phänomen, das sich von Hochdeutsch verabschiedet hat und stattdessen ein hybrides Multilingo spricht, das Türkisch, Kurdisch, Arabisch, Englisch, Bosnisch oder Romanes zu einem urbanen Kiezjargon verwebt.
Ähnlich verwoben, inklusiv, widersprüchlich und im positiven Sinne unfertig ist daher auch das Buch selbst. Es inszeniert sich als offene Materialsammlung, die weder vereinfach noch verklärt. Ihre gründlich ausgearbeiteten Kernthesen werden durch Essays, Interviews, Erfahrungsberichten und Rezensionen ergänzt und ausdifferenziert. In diesen kommen Protagonisten der Szene wie Xatar, Megaloh, Ebow, Eko Fresh, Afrob oder Tice, aber auch andere Kulturschaffende sowie Wissenschaftler zu Wort. So aufgestellt wirft das Buch einen weitschweifigen, kaleidoskopischen Blick auf sein Sujet, der erhellt, erfrischt und immer wieder überrascht.