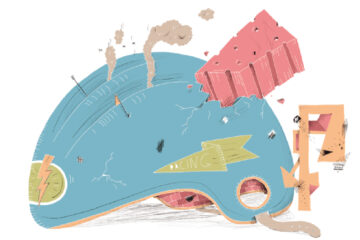»Mach ich, wenn ich ihn sehe«, erwiderte mein Vater immer freudvoll, wenn ihm ein Bayer sein »Grüß Gott!« an den Kopf warf.
Das fand ich als Kind ungemein komisch. Nur wohnten wir in einer Gegend, wo man den süddeutschen Katholiken-Gruß nicht allzu oft hörte. Als ich mich später zum Atheisten und irgendwann zum Agnostiker weitergebildet hatte, war diese komische Nutzformel dann vollends unbrauchbar geworden. Vor einigen Jahren fiel mir aber eine Variation ein, die auch für nicht Gottgläubige und für Polytheisten funktioniert: »Welchen denn?«
Nun kam ich bloß nie dazu meine Replik am lebenden Objekt zu testen, denn ich wohne in einer Stadt, die zum einen keine Grüßgöttler kennt und die von der FAZ auch schon mal als Hauptstadt des Atheismus bezeichnet wurde. »So I take pride in the words: Ich bin ein Berliner«, um hier mal mit einem göttlich verehrten Menschen zu sprechen.
Ich wartete also geduldig auf den Moment, an dem ich meine Pointe zum ersten Mal würde fallen lassen dürfen. Es wurden drei Jahre draus und es war ausgerechnet auf der Herrentoilette eines feinen Hamburger Fischrestaurants, dass mir ein fröhlicher Bayer seinen Gruß entbot: »Grüß Gott!« Er kam durch die Tür, ich stand am Pissoir.
Endlich, endlich, jubilierte ich innerlich. Jetzt bloß nicht zu schnell herausplatzen – aber auch nicht zu lange warten – da sagte ich schon: »Welchen denn?«
Ich kam nicht zum Jubeln und Freuen, denn der Bayer rief sofort ein »Servus!« als Alternative.
Wirklich ein ätzendes Gefühl seinen lang und geduldig erwarteten Triumph nicht auskosten zu können, stattdessen von einem Bayern elegant an die Wand gespielt zu werden. Die Münchner Telefonistinnen der Gema und der VG Wort mit denen man alle Jahre telefonieren muss, gehen auch nie auf den Scherz ein. Viel Freude hat er mir also nicht bereitet.
Mich sprach mal ein freundlicher moslemischer Missionar an. Ich saß mit meiner damaligen Freundin bei Knobi in der Oranienstraße. Wir kamen aus dem Kino und tranken nun Wein, aßen Oliven und Pasten. Gemütlich zu zweit den Film verdauen. Da lächelte er uns von seinem Tisch aus an:
»Entschuldigung, darf ich mit euch über Gott sprechen!«
»Furchtbar nett«, sagte ich, »aber wir wollten hier gerade zu zweit ein bisschen über Film reden.«
Sein Lächeln wurde noch intensiver: »Ich würde gerne mit euch über Gott sprechen, Entschuldigung.« So als könne man dieses Angebot nicht abschlagen.
Ich versuchte es trotzdem: »Nein, danke, sehr freundlich. Wir sprechen gerade über’s Kino.«
»Entschuldigung«, und das Lächeln füllte jetzt sein ganzes Gesicht aus. Etwas Manisches lag in den Augen. »Ich würde Ihnen gerne etwas von Gott erzählen.«
›Okay, bring it on‹, dachte ich. Du hast darum gebeten zerpflückt zu werden. Let’s battle! Ich brachte mich in Positur, drehte mich zu ihm. »Na, denn, bitte.«
»Stellen sie sich mal vor, es gibt eine Fabrik. Und die Arbeiter arbeiten da ganz ordentlich. Und da kommt jetzt einer immer zu spät und tanzt auf der Maschine rum. Was soll der Chef da mit ihm machen? Da muss er ihn doch bestrafen! Und so ist es mit…«
»Jaja, schon begriffen«, fuhr ich ungeduldig ins Wort, »alle Menschen sind die Arbeiter und Gott ist der Chef. Aber was ist dann zum Beispiel mit Freiberuflern? Oder Arbeitslosen? Wo sind die in ihrem Bild?«
Der Mann lächelte jetzt noch doller. Und dieses Lächeln machte mich ganz langsam aggressiv. Es hatte nichts Aufrichtiges oder Freundliches, sondern eine Absicht. Dieses Gönnerhafte fundamental Religiöser, die tatsächlich meinen, die Wahrheit gepachtet zu haben und die glauben, alle anderen armen Seelen hätten dies bloß noch nicht verstanden.Ich hob mein Glas, um scheinbar versöhnend, doch tatsächlich provozierend anzustoßen. Mein Toast: »Auf die Götter!« Da war der Ofen aus.«
Er setzte noch mal an: »Stellen Sie sich vor es gibt eine Fabrik«, und ich wartete auf eine Variation der gerade gehörten Geschichte. Doch er machte exakt mit den gleichen Worten weiter. »Und die Arbeiter arbeiten da ganz ordentlich. Und da kommt jetzt einer immer zu spät und tanzt auf der Maschine rum. Was soll der Chef da mit ihm machen?«
»Ja, tolles Beispiel, habe ich ja verstanden. Aber es gibt doch nicht nur so einfache Fabriken wie im neunzehnten Jahrhundert. Was, wenn die Fabrik in einem sozialistischen Wirtschaftssystem steht? Oder hier in Deutschland: Wo ist da der Betriebsrat? Oder was, wenn es eine Aktiengesellschaft ist? Dann gibt es gar keinen Chef in dem Sinne!«
»Stellen sie sich vor…«, und sein Lächeln wurde jetzt wirklich aggressiv. Es blitze in den Augen.
Die Frau vom Tresen, die irgendwie auf keiner Seite stand, aber in unseren Disput durch pure Anwesenheit in ihrem kleinen Lokal einbezogen war, wurde langsam nervöser. Ich wurde ungeduldiger. Meine Freundin blieb in Beobachterposition.
»Stellen Sie sich mal vor, die Fabrik wird genossenschaftlich betrieben: Dann sind alle Chef!«
»Es gibt nur einen Gott!«, rief er.
»Das kann man so nicht sagen…« Und ich zählte die zwölf Götter auf, die mir namentlich bekannt sind.
»Es gibt nur einen Gott!« Das Redundante schien ihm zu liegen.
»Ich habe Ihnen doch gerade zwölf andere Götter genannt!«
»Es gibt nur einen Gott!« Er wurde wirklich laut. Stieß die Vokale vor erboster Empörung geradezu hervor.
»Ich weiß, ich weiß, die Moslems, die Juden und Christen, die Monotheisten halt, die sich auf Moses beziehen, der laut Thora die zehn Gebote aufschrieb, meinen, das erste Gebot bedeute, dass es nur einen Gott gäbe. Aber das ist ein tautologischer Trugschluss. Das Gegenteil ist der Fall! ›Du sollst keine Götter neben mir haben!‹, sagt doch ganz deutlich, dass es andere Götter gibt, bloß soll der Jahwe- oder Allah-Gläubige eben diese nicht anbeten. Deswegen irren doch die ganzen hundert Millionen Hindus nicht etwa, wenn sie Shiva, Ganesha und den Rest ihres Pantheons anbeten. Und die Apachen mit Manitu. Die Atzeken, die Inkas, die alten Ägypter und Hastenichtgesehens: Kann doch nicht sein, dass die alle Unrecht hatten! Es sei denn, die Atheisten haben Recht und es gibt überhaupt keinen Gott.«
Er schrie jetzt fast: »Es gibt nur einen Gott!«
Die Wirtin versuchte zu schlichten: »Da könnt ihr euch nicht einig werden?« Sie wollte das hier auch abkürzen und hatte wohl Angst, dass die Auseinandersetzung tätlich wird. Der Missionar lächelte auch gar nicht mehr. Ich fühlte so eine Mischung aus intellektueller Überlegenheit ihm gegenüber und Beleidigtsein über das Verlogene seiner vorgetäuschten Freundlichkeit. Und Mitleid wegen seiner Dummheit. Und dann ein bisschen Scham über die eigenen narzisstischen Überlegenheitsgefühle. Und dann dachte ich ›Fuck it‹, ich habe mich einer Diskussion geöffnet, um die ich nicht gebeten hatte. Und ich habe hier offensichtlich die besseren Argumente.
Ich hob mein Glas, um scheinbar versöhnend, doch tatsächlich provozierend anzustoßen. Mein Toast: »Auf die Götter!« Da war der Ofen aus.
Meine Freundin und ich tranken aus und gingen.
Kein Gott zum Gruß. Welchen denn auch?!