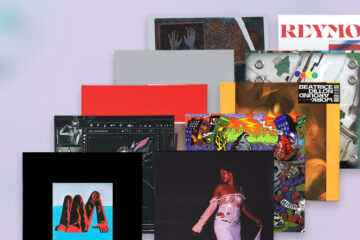1997 war Drum & Bass tot. Noch einige Jahre zuvor, Anfang der 1990er, explodierte das Genre auf illegalen Raves, die Musik energetisch, brutal, forsch und getrieben.
Der Burn-Out folgte schnell. Die Wut war verpufft, die Protagonisten erschöpft. Überhaupt bewegte sich die elektronische Musikszene Mitte der 1990er auf eher stillen Sohlen. Ambient wurde immer esoterischer. Techno blubberte sanftmütig und reduziert. Rave und Hardcore waren zum Witz degradiert. Und IDM musste erstmal überlegen, wie es die neuen Regeln anwenden sollte, mit denen Autechre mit ihrem »Tri Repetae« das Spiel verändert hatten.
Es war zugleich der Aufstieg der ganzen Downbeat-Labels und Lounge-Compilations. All die Jahre des Ecstasy- und Speedkonsums hatten ihren Tribut gefordert. Drum & Bass selbst fraß einem nun aus der Hand. Anstelle der Pillendose macht durchgehend der Joint die Runde.
Das Ende des Vibes
Von LTJ Bukem und 4 Hero über Alex Reese und Photek bis Goldie und Roni Size:ein sanfter Jazz-Vibe bestimmte das generelle Klangbild des Drum & Bass und machte die einst treibenden 160 bpm zum Brunch mit Sektglas. Drum & Bass war plötzlich salonfähig für Vernissagen und Wartezimmer. Natürlich gab es auch noch die laute Variante, doch diese hatte sich zusehends standardisiert und somit uninteressant gemacht.
Gleichzeitig kamen die meisten Drum & Bass-Produzenten nicht über den kleinsten gemeinsamen Nenner der Jazz-Adaption hinaus. Dieser bestand fast immer aus einer nett dahin pluckernden Basslinie und einem (in der Regel im Blue Jazz oder gediegenen Bar Jazz verankerten) trägen Gemütszustand. Die Jazz-Samples wurden in einfachster Manier über die immer gleichen Beatstrukturen gestülpt. Es war reine Sample-Musik, bei der man die Samples hören konnte.»Es soll mehr Head-Fuck werden. Ich habe Head-Fucks immer gemocht.«
Squarepusher
Tja, und dann kam Squarepusher.
In einem Interview mit Jason Gross machte der als Tom Jenkinson geborene Engländer 1999 keinen Hehl daraus, wie gelangweilt er mit dem State of Electronic Music war.
»Die Musik trocknet zusehends aus. Der Vibe hat sich definitiv verflüchtigt. Ich weiß auch nicht, es ist seltsam. Es ist einfach nicht mehr so inspirierend wie die alten Sachen. Die Leute verwenden seit Jahren denselben Ansatz: Piano/Synthesizer, Bass und ein Sampler. Irgendwie müssen wir da neue Ideen reinbringen. Die alten Ideen verwandeln sich immer mehr zu farbloser Musik. Als es 1993/1994 losging, war alles so verdammt abgefahren.«
Jazz auf die Zwölf
»Hard Normal Daddy« gehört eigentlich auch in den Reigen der Jazz-D&B-Alben. Squarepusher steckte als alter Jazzband-Bassist jedoch nicht nur tiefer in der Jazzmusik als die meisten seiner Mitstreiter. Er hat auch seine Rave-Seele und Punk-Vergangenheit nicht vergessen.
Im Gespräch mit Jason Gross verdeutlichte Jenkinson das: »Ich versuche, die ganze Emotion und die Wucht – die physische wie auch rhythmische Wirkung – zu maximieren. Es soll mehr Head-Fuck werden. Ich habe immer Head-Fucks gemocht. Alles, was am Rande entlang schrammt. Ob durch eine wirklich subtile Melodie oder durch einen rhythmischen Angriff, es geht um dieses Gefühl.«
CITI: Es ging Squarepusher darum, an den Grenzen zu tanzen. Bekanntes über den Tellerrand zu schubsen und sich über den Aufprall zu amüsieren.:
Dieser Anspruch macht »Hard Normal Daddy« auch heute noch zu einem der wenigen elektronischen Alben, die künstlerisch-konzeptionell hochanspruchsvoll sind und zugleich Rampensau spielen. Dabei ging es Jenkinson mit »Hard Normal Daddy« nicht einmal darum, in purer Nostalgie den Hardcore-Effekt wiederzubeleben. Es ging immer darum an den Grenzen zu tanzen. Bekanntes über den Tellerrand zu schubsen und sich über den Aufprall zu amüsieren.
Das Album ist streng genommen ein Jazz-Fusion-Album. Nur dass die wunderschönen psychedelischen Melodien allenthalben von wilden Drills und hyperventilierenden Funk-Breaks, delirierende Acid-Lines und Bass-Punches aufgemischt werden. Ganz abgesehen vom irrsinnigen Slap-Bass, den Jenkinson durchs Stroboskop-Gewitter schickt. Das Album ist voller Witz, Fuck-You-Attitüde und musikalischen Finessen.
Was lange brennt…
Seine Fans waren 1997 nicht wirklich von dem Album beeindruckt. Sie hätten lieber den alten Hardcore von Squarepusher gehört, obwohl Jenkinson diesen schon seit mindestens zwei Jahren mehrheitlich hinter sich gelassen hatte. Erst mit der nachfolgenden »Big Loada«-EP und dem epischen, von Chris Cunningham visualisierten »Come On My Selector«, machten sie ihren Frieden mit ihrem Idol. Natürlich nicht für lange, denn nur ein Jahr später sollte Squarepusher zwei verfrickelte Jazz-Alben rausbringen.
Die Zeit heilt jedoch bekanntlich alle Wunden. Nirgends trifft diese Bauernweisheit besser zu, als bei den verletzten Gemütern von Musikfans. Heute gilt »Hard Normal Daddy« bei Squarepusher-Fans als sein Meisterwerk. Selten kann man die verspätete Wertschätzung so gut verstehen wie hier, denn: was zuerst den Kopf fickt, braucht nun mal seine Zeit, um im Gefühl anzukommen.