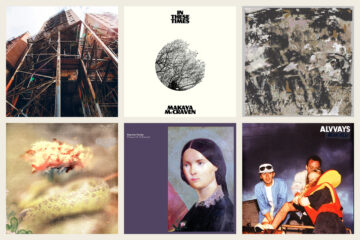Es sind stürmische Zeiten in den Staaten: Black Lives Matter und Corona-Tote, die anstehende Wahl – und Kinder, die im Hintergrund tollen. Während anderswo die Fragen von Journalisten lustlos am Computer per E-Mail beantwortet werden, setzt sich Makaya McCraven hin und spricht seine Antworten sehr bedacht und leidenschaftlich ein. Und was man erst für einen verrückten Beat halten könnte, der im Hintergrund der Aufnahme leicht-chaotisch tönt, stellt sich dann doch schnell als Kindergetobe raus.
»Sorry für den Kinderkrach«, entschuldigt er sich, obwohl dies verzichtbar gewesen wäre. Er war trotzdem sehr verständlich. Und es ist eine besondere Sache, dass sich Makaya McCraven noch die Mühe macht nicht etwa schablonenhafte, vorformulierte Antworten zu bedienen, sondern sich für jede Frage viel Zeit nimmt. Nötig hätte er es sicher nicht mehr, denn der Chicagoer Schlagzeuger gehört weltweit zu einer Riege von Jazz-Musiker•innen, die so gefragt sind, dass sie vermutlich jeden Tag eine Studio-Session und gleich noch ein Konzert spielen könnten.
Spätestens seitdem er 2018 mit »Where We Come From«, dem London meets Chicago-Mixtape, eine Statusmeldung der beiden florierenden Jazz-Szenen in die Welt hinausschickte, gilt er als Superstar der Szene und drüber hinaus. Der Erfolg war ihm vielleicht in die Wiege gelegt: Seine Mutter, Ágnes Zsigmondi, eine bekannte ungarische Chanson-Sängerin, sein Vater, Stephen, spielte mit Archie Shepp, mit Yusef Lateef, mit Harold Ashby. Man traf sich regelmäßig in Amherst, Massachussets, wo sie alle Musik an der Uni lehrten.
Nun gehört Makaya McCraven selbst zu den ganz Großen – neben Kamasi Washington ist er womöglich gerade die prominenteste Stimme des Jazz-Hypes. Dabei ist er zwar Schlagzeuger, also Instrumentalist, seine große Gabe scheint dennoch eher in der Sampling-Komposition des Hip-Hop zu liegen. So erscheint dieser Tage ein B-Seiten-Addendum zum Album »Universal Beings«, die sogenannten »E & F Sides«. Hier werden aus den Stimmen und Instrumenten solch’ profilierter Musiker•innen wie Shabakha Hutchings und Nubya Garcia Beats und Mikro-Kompositionen, die durch Wiederholung und Looping eine trancehafte Wirkung entwickeln.
Was bedeutet »universal being« für dich?Ist Universalität etwas, was du anstrebst mit deiner Musik? Glaubst, dass es überhaupt möglich ist Musik losgelöst von Sozialisation und kulturellen Einflüssen zu hören?
Makaya McCraven: Ein »universal being« zu sein bedeutet einen Faden, der alle Menschen miteinander verbindet, zu erkennen. Und das obwohl es Unterschiede, verschieden Blickwinkel und Sozialisationen, zwischen den Menschen gibt. Andererseits glaube ich nicht, dass man sich von den Einflüssen des Lebens lösen und in einem Vakuum arbeiten kann, wenn es darum geht, Kunst zu konsumieren, zu produzieren, darum, wie uns Kunst berührt. Aber große Kunst hat diese überspannende Qualität verletzbar zu sein und aus tiefliegenden Gefühlen zu entspringen.
Du selbst hast von deinem familiären Background profitiert. Es ist verständlicherweise einfach deine Karriere in einer Traditionslinie zu der von deinem Vater zu sehen, doch was hast du mitgenommen von deiner Mutter und ihrer Musik?
Es stimmt, dass dieser Fokus auf der Karriere meines Vaters nicht die ganze Story erzählt. Meine Mutter war sehr einflussreich. Musiktheoretisch gesprochen: Meine Vorliebe für ungerade Takte, für 7/8 oder 11/8, für Wechseltakte, das kommt von Volksmusiken. Und ich meine nicht nur osteuropäische, sondern auch pan-afrikanische. Ich habe mich sehr mit ungarischen und bulgarischen Volkslieder, mit der Musik der Sinti und Roma auseinandergesetzt. Mich interessiert einfach, wenn Musik »weitergereicht« wird an die nächste Tradition, bloß über die Kultur der Aufführung, von Person zu Person. Meine Ästhetik ist davon stark beeinflusst.
Durch die Karriere deines Vaters hattest du Kontakt zu ein paar der größten Jazz-Musiker aller Zeiten. Wie schlägt sich dies denn nieder in dem wie du Musik und Jazz verstehst? Was hat dich diese Nähe zu ihnen gelehrt?
Ich bin gesegnet, in vielen Formen. So nah und persönlich mit Innovatoren der Musik gewesen zu sein, zeigte mir den Weg, wie man kreativ ist. Das nahm ich sicher mit. Allzu häufig schauen wir auf Jazz als Geste der Verneigung vor den Großen des Fachs, wir imitieren. Doch diese Jungs zeigten mir, wie man ein Original sein kann, wie man seinen eigenen Sound entwickelt. Darüber hinaus lehrte es mich sehr viel darüber, was es heißt ein Musiker oder Künstler zu sein – mit all seinen Auf und Abs. Dieser Moment der Desillusion, der blieb aus; ich wusste, dass es ein langer Weg ist, den man als Künstler einschlägt.
In den letzten zehn Jahren hat sich Jazz sehr verändert. Was glaubst du sind die größten Unterschiede zwischen der Generation deines Vaters und jener Heutigen, mit all den jungen Künstlerinnen und Künstler in Chicago, London oder auch Berlin?
Ich glaube die gesamte Musiklandschaft hat sich geändert, die gesamte Industrie, die Festivalkultur … alles hat sich geändert. Als ich angefangen habe, war es noch diese alte Landschaft – nicht alles, was heute geht, war damals möglich. Einer der größten Unterschiede ist auf jeden Fall, wie junge Musiker•innen Technologie und Aktuelle Musik begrüßen. Aber nicht nur auf der Seite der Künstler•innen, sondern auch auf der Seite des Publikums merken wir diese Veränderung: Dass alle offen dafür sind »zuzuhören«! Es gibt das Verlangen nach Tiefe in der Musik von Menschen, die mehr wollen als nur Mainstream.
»Es gibt das Verlangen nach Tiefe in der Musik von Menschen, die mehr wollen als nur Mainstream.«
Chicago hat zwar diese traditionsreiche Szene, aber es scheint nie aus dem Schatten von New York oder Los Angeles heraustreten zu können – vor allen Dingen international betrachtet. Was sind für dich die größten Missverständnisse, wenn es um Chicagos Musikszene geht?
Ich glaube, Chicago hat dieses »Second-City-Syndrom«. Die Stadt ist eher ein Ort der Arbeiterklasse, ihr fehlt dieser Glam. Du musst hier real sein, korrekt sein, sonst gibt es keinen Respekt der Leute. Andererseits gibt es diesen großartigen Sinn für die Community und Unterstützung. Ein Missverständnis ist jedenfalls, dass Menschen nicht die musikalische Vielfalt dieser Stadt sehen. Man denkt an Blues, an das AACM (Association for the Advancement of Creative Musicians) und die Avantgarde-Musik der Siebziger. Aber es gibt hier reichlich großartige Musiker•innen. Es wird sich dennoch auf diese Traditionen fixiert.
Dein eigener musikalischer Entwurf scheint verschiedene Styles, Genre und Geschichten miteinander verbinden zu wollen. Von den Hip-Hop-Instrumentals, die wir von Stones Throw kennen bis hin zu den Free Jazz-Experimenten des New Yorks der Sechziger. Für die »Universal Beings«-Releases bist du nach London und in die genannten Städte gereist. Was hat es für dich bedeutet, diese Städte zu bereisen und die verschiedenen Szenen kennen zu lernen?
Ich bin so aufgewachsen, dass ich mich schon immer mit mehreren Städten gleichzeitig verbunden gefühlt habe. Als ich nach Chicago kam, wurde in der Stadt vor allen Dingen über die Stadt selbst geredet. Mein Blick auf die Dinge war etwas weiter gefasst. Ich hatte eben nie bloß eine Heimatstadt, ein Ort, der mich definiert hat. Reisen ist da eine Möglichkeit der Sinneserweiterung: Man trifft Leute, die die eigenen Erwartungen und die Art wie wir denken, fordern. Mir ging es immer darum mit möglichst vielen Menschen zusammen zu spielen – und von ihnen zu lernen. Das Wunderbare am Reisen ist ja, dass man mit so vielen Erfahrungen und Bekanntschaften belohnt wird. Ich glaube, wir würden uns alle besser behandeln, wenn wir nur besser connected wären.
Related reviews
Brandee Younger
Brand New Life
Makaya McCraven
In These Times
Gil Scott-Heron
We're New Again - A Reimagining By Makaya McCraven
Was bedeuten dir eigentlich die Worte Pastiche, Remix und Sampling? Was passiert für dich wenn du deine Tracks cuttest und slicest? Versuchst du da Jazz von seinen Fesseln zu befreien?
Sampling bedeutet für mich: Nehme einen Sound und gib ihm ein neues Konzept. Ich würde zum Beispiel die Platten, die ich mache, nicht als Remix sehen. Ich nehme Fragmente und Stellen und collagiere sie zusammen; deswegen nannte man mich schon einen Beat-Wissenschaftler. Ich denke eher als Beat-Archäologe von mir. Ich grabe Sound aus. Cutting und Slicing sind für mich die Kunst dem Prozess zu folgen und zu lernen, was man überhaupt machen möchte – per Trial-and-Error-Verfahren. Als ich mich mit Hip-Hop beschäftigt habe, habe ich gelernt, dass es Dinge gibt, die du nicht mit Instrumenten machen kannst. Aber ich versuche trotzdem nicht Jazz von irgendetwas zu befreien. Ich muss gar nichts für Jazz machen, versuche bloß die bestmögliche Musik zu machen, die ich machen kann. Ich weiß noch nicht einmal, ob das Label »Jazz« das richtige für mich ist. Klar, es ist ein passender Terminus, der akkurat beschreibt, wie ich Musik angehe. Ich sehe aber selbst keine Notwendigkeit es so zu labeln.
Glaubst du eigentlich, dass es ein Zufall ist, dass Jazz aus Chicago und London gerade so gefeiert wird und gleichzeitig Black Lives Matter auf die Straßen geht und fordert, dass mehr Schwarze Geschichten und Stimmen gehört werden? Oder kommt beides von der selben Quelle?
Das ist kein Zufall. Ich würde es zwar nicht deduktiv rahmen wollen, aber es ist eben so, dass ich auf junge Menschen schaue, die Musik machen, die eben auch Teil DIESER Generation sind. Es sind dieselben Personen, die Instrumente spielen und die, die auf der Straße stehen. Die Kunst reflektiert hier, was in der Welt passiert, und auch andersrum: Kunst projiziert eine Zukunft, in der solchen Forderungen nachgegeben wird. Kunst ist immer Gestern, Heute und Morgen. Das alles passiert nicht in einem Vakuum. Und Musik ist eben das Leben selbst.