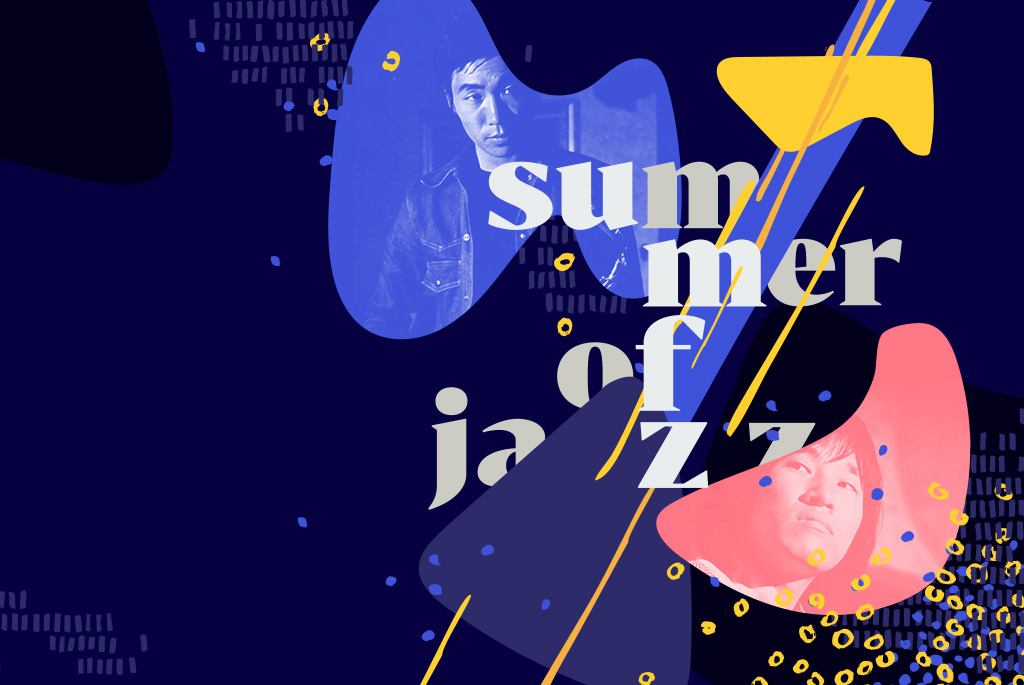Jazz-Pianist Horace Silver tat es im Jahr 1962 mit »The Tokyo Blues«, sein Kollege Dave Brubeck zog zwei Jahre später nach mit »Jazz Impressions of Japan«, selbst Duke Ellington spielte sie ein unter dem Titel »The Far East Suite« ein: Kompositionen inspiriert vom Land der aufgehenden Sonne. Spektakulärer als die exotischen Aufnahmen der Jazzlegenden ist jedoch der Kontext, in dem sie entstanden: das Ringen der Japaner selbst um Jazz, eine Geschichte im Spannungsfeld zwischen Imitation und Innovation, sie erzählt von einem schleichenden Kulturwandel, der das Selbstverständnis japanischen Musiker umkrempeln sollte.
Schallplatten mit japanischem Jazz findest du bei hhv.de.
Der Jazz kam übers Meer
Auf Ozeandampfern, die vor dem Ersten Weltkrieg zwischen Yokohama und San Francisco, Hong Kong und Shanghai pendelten, spielten Boardbands die neuesten Stile, etwa den Ragtime. Erfolgreich an Deck waren damals noch Musiker von den Philippinen. Die USA besetzten deren Heimat seit 1902, mit den musikalischen Spielarten waren sie dadurch bekannt und vertraut. Diese viel geachteten »Väter der japanischen Jazzmen« importierten Noten und selten sogar Bluesaufnahmen, aus ihrem Spiel speiste sich die Euphorie um Tanzmusik zwischen den Weltkriegen. Besonders der symphonische Stil von Paul Whiteman erfreute sich im damaligen Japan großer Beliebtheit, der »Jazzkönig« prägte den Geschmack der Einwohner weit mehr als etwa der hot jazz von Louis Armstrong. Die Musiker, die ihre Spielpraxis meist in der Armee oder auf den Schiffen gesammelt hatten, spielten in vollen Tanzlokalen, Plattenfirmen stellten sich ihre eigenen Orchestren zusammen, um der Nachfrage nach Jazz gerecht zu werden.
War das Genre in den 1920er und 1930er Jahren noch der Sound des Aufbruchs, verebbte die kollektive Begeisterung, als sich das Land politisch radikalisierte, nationale Kräfte an Macht und das Militär an Einfluss gewannen. Fortan war Jazz als unmoralische »enemy music« gebrandmarkt, die den kulturellen Verfall symbolisierte – bis die Herrschenden umschwenkten und begannen, die Musik als Propagandainstrument für ihre Werte zu begreifen. Zwischen diesen beiden Polen navigierten die Jazzmusiker Japans und versuchten, mit »salon music« das Genre am Leben zu halten. Diese mildere, zensorengefälligen Spielart unterhielt die Arbeiter in den Fabriken und schaffte es sogar ins Staatsradio.
Erst abgehängt, dann angepasst
Das Dahinplätschern hatte ein jähes Ende, als nach Ende des Zweiten Weltkrieges die US-amerikanischen Streitkräfte im Land stationiert wurden. Denn was die Soldaten aus ihrer Heimat mitbrachten, hatte nichts mehr mit dem Big-Band-Sound der Vorjahre zu tun. Was die Musiker in den Truppen spielten, war herber, hektischer, komplizierter, als alles, was die japanischen Musiker zuvor gehört hatten. Die Entwicklung des Bebop und Cool Jazz war an ihnen vorbeigezogen, nun schien es den japanischen Jazz-Fans, als müssten sie eine neue Sprache lernen. Das Gefühl, musikalisch abgehängt worden zu sein, dominierte. Trotz – oder gerade wegen – des Drucks erwiesen sich die einheimischen Jazzmusiker als lernbegierig und anpassungsfähig. Flexibel in den Stilen mussten sie ohnehin sein: Zu Hunderten tummelten sie sich täglich an Bahnstationen, auf Lastwagen wartend, die sie aufgabelten und in US-Stützpunkte, in die Vergnügungslokale der Soldaten fuhren.
Nach Abzug der Amerikaner im Jahr 1952 wurde das Land vom »Jazz Boom« ergriffen. Allen voran schlug das Herz der japanischen Jugend für kokujin jazz, also schwarzen Jazz. Afroamerikanische Stars wie Horace Silver und Art Blakey galten als das Ideal, dem die Fans huldigten und die Musiker nacheiferten – in den wie Pilze aus dem Boden schießenden Theatern, Bars und Tanzlokalen der Städte und im Fernsehsender NHK, dem Hauptarbeitgeber der Jazzmusiker. Eine Schlüsselrolle spielten auch die jazu kissa, Cafés so klein wie Schatullen mit so vielsagenden Namen wie Duke oder Blackbird. Den kostspieligen Import amerikanischer Platten übernahmen die Eigentümer. In glamourösem Ambiente und meditativer Andacht lauschten meist nur eine Handvoll Jazzliebhaber dem neusten Schrei und notierten die Partituren, die sie hörten.
Akiyoshi & Watanabe: Mutter und Vater des japanische Jazz
So auch Toshiko Akiyoshi. Sie sollte zu einer Pionierin des japanischen Jazz werden. Eigentlich hatte sie eine klassische Klavierausbildung genossen. Aber nachdem sie Teddy Wilsons »Sweet Loraine« gehört hatte, wusste sie, dass der Jazz ihre neue Heimat werden würde. Mit ihren Bands hatte sie zunächst Schwierigkeiten, Engagements zu bekommen, weil sie nicht das spielten, was tanzbar war – sondern etwas Eigenes. 1953 scoutete der kanadische Pianist Oscar Peterson sie, als sie tagsüber in einem jazu kissa spielte. Erste Aufnahmen folgten, 1956 schickte ihr das Berklee College of Music Flugtickets, um ihr Talent fördern zu dürfen. Auf ihrem Debütalbum »Kogun« (1974) finden sich ihre ersten Kompositionen, die Einflüsse japanischer Musik und einen »horizontalen« statt der in westlicher Tradition üblichen, vertikalen Aufbau der Musik wagen. Heute gehören zu den zahlreichen Auszeichnungen ihres Werkes u.a. 13 Grammy-Nominierungen.
Ende der 1960er Jahre wuchs das respektvolle Rezipieren in den jazu kissa an zu einer regelrechten Ehrdarbietung der amerikanischen Jazzlegenden. Art Blakey, der mit seinen Jazz Messengers 1961 im Land gastierte, verglich den betriebenen Werbeaufwand mit dem der Beatles. Sogar eine kaiserliche Audienz wurde ihnen zugestanden. Das zweite Konzert, das einen prägenden Eindruck auf die japanische Jazzgemeinschaft machte, war der Besuch des Miles Davis Quintett drei Jahre später. Im Zuge des »rainichi rush« – rainichi heißt so viel wie »komm’ nach Japan« – reisten viele amerikanische Größen wie Thelonius Monk oder Dave Brubeck an. Die dortige Fangemeinde dürstete es nach dem Original, sie trugen sogar die in Übersee üblichen ivy-league-Looks.
Kombiniert mit dieser Imitationsfreude drohte die uneingeschränkte Begeisterung für das afroamerikanische Vorbild aber auch das vereinzelte Interesse an Innovation zu ersticken. Es brauchte erst den Weggefährten Toshiko Akiyoshis, Saxophonisten Sadao Watanabe, der ihr in die USA gefolgt war: »Als ich brasilianische und afrikanische Musik, auch andere Annährungen an Jazz hörte, wurde mir klar, worauf es ankommt: Gefühl. Die beste Musik ist die, die vom Leben kommt.«
Um diese Erkenntnis bereichert, kehrte er zu einer Zeit zurück in seine Heimat, in der alles nach Stillstand klang: Aufgrund von Drogendelikten war die Verwaltung immer weniger geneigt, amerikanischen Musikern Visa auszustellen. Es ergab sich ein Vakuum. Der renommierte Watanabe war fest entschlossen, es mit einer selbstbewussten Generation junger Musiker auszufüllen. Mit Musikern – unter ihnen der Komponist Masabumi Kikuchi als Schlüsselfigur –, die keine Furcht mehr hatten, dass ihr eigenes Original neben dem Vorbild aus den USA verblassen könnte.

Allgemein bleibt festzuhalten: Auf den neuaufgelegten Platten mit Jazz aus Japan aus den späten 1960er bis zu den frühen 1980er Jahren hört man förmlich, wie die Szene ihrem Minderwertigkeitskomplex entwächst. Spieltechnisch bewandert und fachkundig aufgezeichnet bieten Produktionen dieser Ära einen guten Eindruck der Ansätze, Jazz auf japanische Art zu denken – und das jenseits der Entlehnung volksmusikalischer Elemente oder des Einsatzes regionaler traditioneller Instrumente.