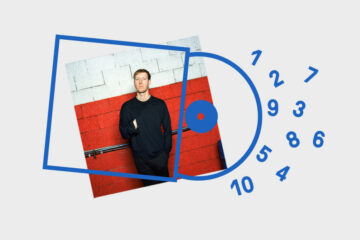Die Stimme der Pophoffnung 2011 ist eine Unverschämtheit: Sie leiert und nölt nur so vor sich hin. Ein gebrechliches Wimmern, welches dumpf unter dem dicht geknüpften Beatteppich hervordringt, drehend und windend dem Würgegriff der Technik entkommt, sich entzweit und schließlich selbst begleitet. Scheinbar unbeholfen balanciert der Gesang auf dem verschobenen Takt zwischen unmenschlichen Roboterlauten und herzerwärmendem Falsett. Das blechern tönende Organ gehört dem Briten James Blake, der mit gerade einmal 22 Jahren, einer klassischen Klavierausbildung und einem Studium am Londoner Goldsmith’s College für bildende Kunst im vergangenen Jahr von Magazinen und Blogs gleichermaßen zum Heilsbringer der elektronischen Popmusik erkoren wurde. Mit seinem selbstbetitelten Album zeigt er nun eindrucksvoll, warum.
Junger Bursche, very british*Sie alle nehmen dem Dubstep seine Verkopftheit oder den kommerzialisierten Charakter und bestückten ihn mit ihrer eigenen, offengeistigen Attitüde.
Blake ist ein junger Bursche, Marke very british: Gedrungene Gestalt, den Kopf schüchtern zwischen den Schultern versteckt, rötliches Zauselhaar, blasse Haut – fast ein bisschen unscheinbar. So jemand hat nicht viele Freunde, möchte man meinen. Ein Frickler, ein Nerd, ein Kauz eben. Vielleicht aber auch einfach nur ein ehrgeiziger Eigenbrötler, gesegnet mit einem musikalischem Selbstverständnis und einer hypnotisierenden Stimme gleichermaßen. Denn mit genau dieser perfekten Symbiose aus verspielten Details und dem Mut zum vielsagenden Nichts in der Musik so wie der unaufdringlichen Präsenz seines modifizierten Gesangs hat James Blake der elektronischen Musik eine Stimme und deren stets mit einem Hang zur Anonymisierung kokettierenden Szene (wieder) ein Gesicht gegeben.
Zudem ist der Sonderling Vorreiter eines Genres, welches sich im letzten Jahr aus dem konsensgeschwächten Dubstep herauskristalisierte – Blake macht Post-Dubstep. Es ist dieser Terminus, welcher die eklektische Spielweise einer jungen Garde an Produzenten und DJ’s wie eben James Blake, Mount Kimbie, Pariah oder auch Jamie xx, Teil der britischen Überband The xx, beschreibt. Sie alle nehmen dem Dubstep seine Verkopftheit oder den kommerzialisierten Charakter und bestückten ihn mit ihrer eigenen, offengeistigen Attitüde. Bassläufe in der Toncoleur eines Sägewerkes, synkopische Beatgerüste – all diese typischen Merkmale lassen sich nur noch als unaufdringlicher Referenzrahmen erahnen.
Das Yin und Yang des Wobbelwahnsinns
Den Weg in die Hypelisten ebneten James Blake gleich drei Veröffentlichungen im EP-Format: Während die Klavierwerke-EP eher der klassischen Pianoschule huldigte, lieferten CMYK und The Bell Sketch eine wohlkompilierten Statusbericht über Blakes Sozialisierung zwischen klassischem Garage, charterprobtem R’n’B und sphärischem Dubstep. Hier beschnitt und verdrehte er gesamplete Sprachfetzen bis zur Unkenntlichkeit, dort platzierte er Mollakkorde akkurat auf dem Takt.
Die Verschmelzung dieser detailverliebten Herangehensweisen verfolgt James Blake auch auf seinem Debüt. Schon der Opener Unluck gibt die Marschroute vor. Asynchrone Soundbits in dumpfer Klangart als Ersatz für die Snare und tappsende Synthies, nur im Zaum gehalten von klackernden Hi-Hats. Was sich auf dem Papier wie die reinste Dissonanz liest, klingt auf Platte so selbstverständlich, wie nur irgendwie möglich. Kein Takt ist vorhersehbar, kein Ton dort, wo er sein soll. Der verspielte Glitch auf I Never Learnt To Share schraubt sich Sekunde um Sekunde tiefer in den Gehörgang und mutiert zu flirrendem Wobblewahnsinn. Die Musik gleicht einem sich immer schneller drehenden Strudel an Takten und Klängen, die James Blake gekonnt um seine Stimme konstruiert und sich manchmal sogar in ihr verliert – oder wie in The Wilhem Scream – sogar von ihnen überrollt wird. Nicht verwunderlich, dass James Blake mit seiner ganz eigenen Spielweise auf dem besten Weg ist, sich als Referenzwerk auch nachhaltig einen Platz im Musikkosmos zu sichern. Es ist das Mehr und das Weniger. Das Alles und das Nichts. Blake lässt der Musik ihren Raum. Sie kann sich entwickeln.
Herrliche Gänsehaut*So persönlich und ehrlich hat die Stimme in der elektronischen Musik selten geklungen.
Mit seinem Debüt zeigt Blake nun, dass sein Talent beileibe nicht nur auf das technische Know-How und die raffinierte Komposition von zeitgemäßem, in alle seine Subgenres ausgefranstem Dubstep beschränkt. Er tritt nun auch als Sänger in Aktion. Mit einer Stimme, die einem eine herrliche Gänsehaut beschert und wohlig den Gehörgang kitzelt. In Measurements etwa legt Blake, einem Gospel gleich, seine be- oder entschleunigten Gesangsspuren übereinander – nur begleitet von einem angedeuteten Basslauf in der linken Hand. Dann presst er seine Klagelaute wieder durch den Vocoder oder verlängert die getrimmten Töne bis ins Unendliche. Hier paart sich ein zartes Hauchen mit überdrehtem Krächzen, um von einem vielsagenden Seufzen in schmerzvolles Wimmern zu mäandern. Blake spricht alles aus und lässt seine Gedanken unkontrolliert und doch stets on point durch die Musik zucken – so persönlich und ehrlich hat die Stimme in der elektronischen Musik selten geklungen.
Das Trojanisches Pferd ist gesattelt
Freilich: Elektronische Musik hat schon immer auch emotionalisiert – aber der Hang zum euphorischen und dem roten Faden in Form einer Dur-Färbung war bei einer für den Tanz im Club konzeptionierten Musik nie von der Hand zu weisen. Wenn James Blake dieser Musik nun einen melancholischen Dreh gibt und damit so den Nerv der Zeit trifft, dann ist das schon besonders. Das beste Beispiel hierfür ist mit Sicherheit die erste Single Limit To Your Love. Sie ist eine raffinierte Cover-Version des gleichnamigen Stücks von Feist: Soulige, auf das Nötigste reduzierte, Vocals, herrlich schummernde Subbässe, hingehauchte Klavierakkorde und eine gehörige Portion Stille. Er klingt dabei nicht ganz so unkonventionell wie die restlichen Songs auf dem Album. Es ist ein trojanisches Pferd, welches Blake dort – bewusst oder unbewusst wohlgemerkt – gesattelt hat. Die raffinierten Songwritingqualitäten einer Leslie Feist paaren sich hier mit dem blake’schen und irgendwie auch allgemeingültigen musikalischen Zeitgeist anno 2011. Damit erreicht man eben nicht mehr nur die Anhängerschaft der 500er Auflage seiner ersten EP. Der konsequente Dreischritt vom Forkcast-Geheimtipp, über die Durchreiche in den Feuilletons, welcher schließlich im größten gemeinsamen Nenner des ersten Quartals, auf den sich alle – bis auf den Spiegel – einigen konnten, gipfelte, war also nur eine Frage der Zeit.
Kid xx*Give Me My Month fordert Blake auf seinem Debüt. Warum so bescheiden? Wenn man ehrlich ist, könnte es sogar sein Jahr werden.
Aber auch, wenn Blake sich mitunter den Vorwurf des Konsenskünstlers gefallen lassen muss, ist es doch erstaunlich, wie sehr dieser 22-jährige Sonderling es mit einem Laptop, Effektgeräten und – zugegebenermaßen – enormem musikalischen Verständnis so sehr Puls der Zeit zu treffen, dass Vergleiche mit wegweisenden Popmomenten wie der Veröffentlichung eines Albums wie Kid A von Radiohead oder XX von The xx nicht weit hergeholt, sondern vielmehr schlüssig und verständlich sind. James Blake vollzieht die Entmenschlichung und gleichzeitige Multiplikation seiner Persönlichkeiten zu einem großen Ganzen – stets schwingt dabei die scheinbare Teilnahmslosigkeit und doch vollkommene Bewusstmachung mit. James Blake spricht das aus, was viele nur dumpf empfinden und schafft es, das unausgesprochen zu Vertonen. Natürlich ist das oft nur vage und tendentiell, oberflächlich und unüberlegt.
Aber genau diese Divergenz schafft die Basis für die mutige Annahme der Journaille, James Blake sei der erste Singer-Songwriter der noch jungen digital natives – denn er schafft es, diese bestimmte Unentschlossenheit auf den Punkt zu bringen und sie zeitgleich herrlich undefiniert auf sich beruhen zu lassen. Eine unumstößliche Analogie auf die Charakteristika der twenty-somethings. Seine Songs sind keine Standortbestimmungen, sondern lediglich Tendenzen. Seine Stimme wirkt zu keinem Zeitpunkt fest verankert, sondern tastet sich vorsichtig voran und hält sich alles offen. Die Selbstverständlichkeit mit der er in diesem Alter ein derart dichtes und abgeklärtes Album abgeliefert hat, ist fast beängstigend. Give Me My Month fordert Blake auf seinem Debüt. Warum so bescheiden? Wenn man ehrlich ist, könnte es sogar sein Jahr werden.