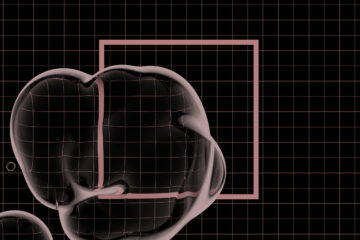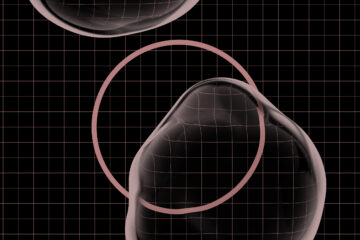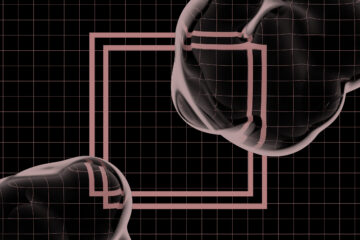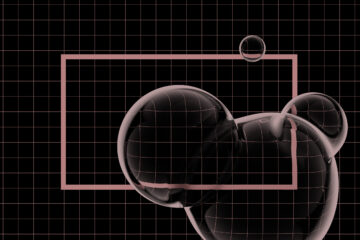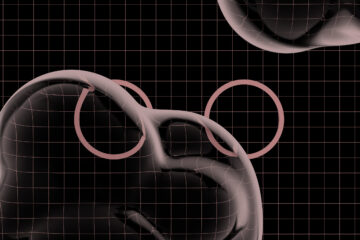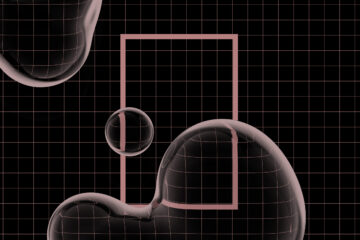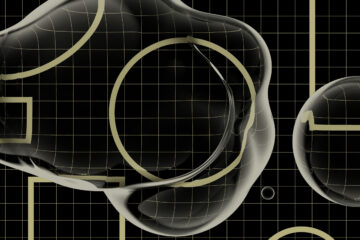Das Leben hinter den Masken
Drake war wirklich nicht der Erste, der mit der Eleganz einer vom Gegenwind gebeutelten Mülltüte einen Tanz hinlegte. Auch wenn seine stockigen Schunkel-Moves vor wohltemperierten Ambilight-Background im Video zu »Hotline Bling« das Jahr 2015 dominierten, findet sich ein Vorläufer im vorangegangenen: Als die Future Islands im März 2014 bei Talk Show-Host David Letterman ihren Song »Seasons« vorstellten, sorgte das nicht etwa deshalb für Gesprächsstoff und Begeisterung, weil die musikalische Leistung herausragend gewesen wäre. Was hingegen die Gemüter erregte, waren die Gummigelenk-Moves von Sänger Samuel Herring. Wie bei Drake ging es rechts runter, links runter und der Kopf schien zu machen, was er wollte. Zusätzlich holte Samuel Herring noch alle Feuerzeug-in-the-air-Pathos-Gesten der Rockgeschichte raus. Da schwollen die Halsadern an, bis sie kurz vorm Platzen waren. Dazu die Vocals: Gutturales Growlen nah am Death-Metal-Gekehle. »Buddy, come on!«, schrie Letterman überwältigt, noch bevor der letzte Ton verklungen war. Überraschung, Begeisterung, Sprachlosigkeit über so viele echte Gefühle. Eine Kapitulation vor dem authentischen Ausdruck.
Auf Drakes »Hotline Bling«-Video wurde anders reagiert. Breiter zum einen, denn die inszenierte Awkwardness ist in mehr als einem Jahr aus dem Late Night-Dunkel ins Spotlight geschliddert. ###CITI: 2015 hörte Pop großflächig damit auf, sich um Authentizität und Echtheit zu scheren. Womöglich, weil die Welt um uns so echt wurde, dass es weh tat.:### Vor allem aber wurde auf »Hotline Bling« reagiert wie auf Drake immer reagiert wird: Mit Memes, Memes und noch mal Memes. Drake weiß das und vielleicht sogar legt er es darauf an. Das Video zu »Hotline Bling« wurde um ein Vielfaches erfolgreicher als der eigentliche Song, der es nicht einmal auf den ersten Platz der Billboard Hot 100-Charts schaffte. Spott, Häme und der Fremdschamgenuss über so viel artifiziellen Quatsch.
Gegeneinander gehalten könnten die beiden Videos bis auf den überdrehten Tanzstil ihrer Protagonisten unterschiedlicher kaum sein. Auf der einen Seite die Überdosis Authentizität des Future Island-Sängers, auf der anderen abgeklärte slickness Drizzys. Dabei allerdings fußt der emotionale-Erpressungs-Rap von Drake womöglich auf mehr genuinen Gefühlen als Samuel Herrings keuchendes Körperpathos. Beide schaffen es jeweils im selben Zug, echt und unecht in einem zu sein. Ein Paradox.
Was sich bei den Future Islands Anfang 2014 erstmals sichtbar abzeichnete, gipfelte im letzten Jahr mit Drake – und nicht allein ihm. 2015 hörte Pop großflächig damit auf, sich um Authentizität und Echtheit zu scheren. Womöglich, weil die Welt um uns so echt wurde, dass es weh tat.
Denn wann sprechen wir eigentlich von Realität? Vor allem dann, wenn wir über die schlimmen Dinge des Lebens reden. 2015 waren das ganz schön viele, auf nationaler, europäischer und internationaler Ebene. Die schlechten Nachrichten hörten nicht auf, sie wurden nur noch schlimmer. Es gab vor ihnen und ihren Konsequenzen kein Entrinnen. Eskapismus schien deswegen keine Option mehr.
Pop stemmte sich weder dagegen noch verflüchtigte es sich. Stattdessen tanzte es vor glatten Neonwänden, und seufzte: »You used to call me on my cell phone«. Es reicht nicht mehr, gehört zu werden und zu hören. Es muss gesehen werden. Pop braucht seine Bilder, schrieb auch Diedrich Diederichsen in seinem Mammutwälzer »Über Pop-Musik« und es fällt schwer, dem zu widersprechen. Je mehr die Welt jedoch von Bildern geprägt wird, desto mehr wird Pop von ihnen abhängig. Je mehr diese Bilder manipuliert und verdreht werden können, desto unechter wird »Pop-Musik«. Ob sie will oder nicht.
Die Körper treten deshalb in den Vordergrund. Es sind nur keine echten mehr. Sie behaupten es auch nicht. Sie werden inszeniert und sie mutieren.
In einem anderen Aufsehen erregenden Video des Jahres 2015 ist ein weißer Schluffi zu sehen, der um einen Rolls Royce tanzt. Seine ganze Erscheinung ist mehr als bizarr: Braids, Grillz, schamhaariger Nackenbart, weites Shirt und enge Jeans, die Füße stecken in Yeezy-Merch. Post Malone legte im Februar mit »White Iverson« den Raktenstart des Jahres hin. Nicht etwa, weil er ein Klischee ist – sondern weil er alle Klischees auf einmal ist. Ein zum Leben erweckter tumblr-Account aus der Trailer Park-Zone des Internets. »White Iverson« dreht sich zu einem Drittel um die Basketball-Leidenschaft Post Malones, zu einem Drittel um den titelgebenden Spieler, reproduziert zu einem weiteren Drittel hedonistische Rap-Klischees von »Bitches« und »Weed« und hat im Gesamten keine nennenswerte Message.
»White Iverson« sagt hingegen sehr viel darüber aus, wie unwichtig es geworden ist, die Codes bestimmter Subkulturen mit Leben zu füllen, sprich die im Rap immer schon wichtige realness zu verkörpern. Post Malone ist das Gegenteil von Authentizität. Er ist alles andere als echt. Die schwammigen Gefühle, die in »White Iverson« durch eine leere Ästhetik gepresst wurden, allerdings schon. »It makes me happy«, singt Post Malone und bleibt in seinen genius.com-Annotationen zum Song eine Erklärung darüber schuldig, was genau ihn eigentlich glücklich macht. Hauptsache Gefühl. Drake hingegen drückt in »You & The 6« ein umso authentischeres Problem aus, dass ihm nämlich die gelebte Authentizität abgesprochen wird: »I used to get teased for being Black / And now I’m here and I’m not Black enough«. Post Malone hingegen muss sich, anders als Eminem zu seinen Zeiten, kaum dafür rechtfertigen, dass seine Karriere die white fruit of Black roots ist.
Vom Absonderliche zum Normalzustand
Künstler wie Drake und Post Malone schauspielern sich selbst. Hinter der Maske ließ es sich 2015 leichter leben, zumal kaum noch jemand nach dem fragt, was dahinter liegt. Schrecken, Begeisterung – das alles weicht schneller als zuvor der Gewöhnung. Als die Future Islands im April 2015 zu David Letterman zurückkehrten, um ihren Song »The Chase« zu performen und Samuel Herring ein ähnliches Pathos an den Tag legte, wirkte das nicht mehr außergewöhnlich. Kein »Buddy, come on!« von Letterman, sondern nur noch ein lapidares »There you go!«. Danke für die Showeinlage, jederzeit wieder – ruf uns nicht an, wir melden uns bei dir. Das Absonderliche war plötzlich zum Normalzustand geworden, die Überraschung blieb folglich aus.
Drake und Post Malone sind Jahrzehnte und eine gründliche mediale Umwälzung von der Behauptung Chuck Ds entfernt, Rap sei »CNN for Black people«. Zwar gibt es die alte Schule noch, sie muss aber immer kunstfertiger werden, um mithalten zu können. Während Kendrick Lamar oder Vince Staples die Lebensumstände der schwarzen Community auf ihre Art massentauglich verdichten und Haftbefehl selbst vom Feuilleton für seine (vermeintlich) authentische Gossenprosa gefeiert und auf post-strukturalistische Machtanalysen hin gedeutet wird sind übersteigerte Kunstfiguren von Kollegah bis Money Boy und seinen etlichen Epigonen die Lieblinge der deutschen Mittelschicht jüngeren Alters.
Money Boys Karriere begann treffender Weise in der scripted reality des Privatfernsehens sowie als YouTube-Viral und beschäftigt eine riesige Zielgruppe, von der nicht immer ganz klar ist, wie ironisch oder aufrichtig sie den aufgedunsenen Österreicher wirklich abfeiern. Zumal der 34-jährige Sebastian Meisinger selbst wohl kaum noch wissen kann, wo seine Persona aufhört und die eigene Identität anfängt. So distanziert und ironisch sich Money Boy gibt: Er verwächst umso enger mit seiner Rolle. Wie bei Future Island macht die bloße Wiederholung das Absonderliche zum Normalzustand, wie bei Post Malone wird das Fremde irgendwann zum Eigenen. Was auch immer hinter Mbeezys Maske liegt, wird langsam von ihr aufgesogen. Denn solange irgendwo ein videofähiges Smartphone in der Nähe ist, dreht Meisinger den Swag auf. Es ist immer ein videofähiges Smartphone in der Nähe.
Die uns umgebene Technik ist mittlerweile dermaßen in unser Leben integriert, dass Holly Herndon nicht zu Unrecht behauptet, der Laptop sei vielleicht das intimste Instrument unserer Zeit. Vor gar nicht allzu langer Zeit sah das ganz anders aus. Cher machte Mitte der 1990er Jahre Autotune bekannt, weil sie ihre eigene Stimme scheiße fand. Zu einer Zeit, als artifizieller Eurodance Hochkonjunktur hatte, passte sich das ästhetisch ein, zwischen ihr und ihrem Publikum aber klaffte das Uncanny Valley kilometerweit auf. Autotune bedeutete für Cher die Flucht vor der Realität des eigenen Körpers und für ihr Publikum einen kleinen Schock. Heutzutage kommt ein Future, der über sehr reale Themen rappt, gar nicht mehr ohne ihn aus – das absonderliche Markenzeichen ist zu seiner Essenz geworden. Bei Post Malone fällt sie überhaupt nicht mehr auf.
Anders Kendrick Lamar, der im Finale von »To Pimp A Butterfly« einen kongenialen Kompromiss wählt und in ein Zwiegespräch mit 2Pac eintritt, das gleichzeitig (selbst-)verklärend wie ernüchternd ist. 2Pac ist tot, er kann nicht antworten. Es ist eine bizarre, vollkommen künstliche Situation. Das gemeinsame Lachen von Kendrick Lamar und dem Idol ist ein schmerzhaft post-dramatischer Einschnitt in eine Platte, die ihre Melodramatik aus der harschen Alltagsrealität bezieht. »What’s your perspective on that?«, lautet Lamars letzte Frage an Pac, sie bleibt unbeantwortet. Die Vergangenheit schweigt sich über die Zukunft aus. Was Allen Iverson für Post Malone ist, das ist das Gespenst 2Pac für Kendrick Lamar: Das unerreichbare Ziel einer sehr echten Sehnsucht. Pop hat 2015 also aufgehört, Antworten auf simple Fragen zu liefern. Manchmal antwortet sie gar nicht mehr.
Selbst im authentizitätsangereicherten Punkrock lieferten mit The World Is A Beautiful Place & I Am No Longer Afraid To Die und Self Defense Family zwei Bands neue Alben ab, die eigentlich keine Bands mehr sind, sondern sich als lose Kollektive mit rotierender Besetzung verstehen. Das bietet keine Identitätsfläche mehr.
Die ehemals fixen Identitätsflächen schmelzen und verflüssigen sich. Es gab 2015 viel Wasser zu hören, etwa auf Holly Herndons Album »Platform« oder in den Lyrics von Kelela. Das Fluide ist auch der Modus, in dem sich every critic’s darlings Arca und Jesse Kanda bewegen. Ähnlich die Musik von zum Beispiel Lotic, der sich zwar durch Sampling eindeutig in queere, von people of colour geschaffene Traditionen einreiht, sich ästhetisch aber nicht verschubladen lässt. Instrumental Grime war eines der Buzzwords des Jahres, es handelt sich um einen ziemlich diffusen Begriff. Eine definitorische Käseglocke, unter deren Rand es durchsickert. Genres, Subkulturen und ihre Codes sind keine Bezugssysteme mehr, sondern nur noch Referenzpunkte. So wie etwa Post Malones Braids und Grillz auf eine schwarze Hip Hop-Kultur verweisen und seine Hose auf eine weiße Hipsterigkeit. Ein ganzheitliches Bild kann das eigentlich nicht ergeben und doch tanzt dieser Typ am Ende der Echtzeit melancholisch um einen geliehenen Rolls Royce.
Körper, Haltungen und Körperhaltungen
2015 spielten sich die dringendsten Identitätskonflikte am Körper ab. Zumeist in einem Bereich, in dem soziales Konstrukt mit vermeintlicher biologischer Realität aneinander reiben: Wenn sich Björk für das Cover von »Vulnicura« eine Vagina in die Brust einbauen lässt, ist das eine konfrontative Ansage an überholte Konventionen in Sachen Gender.
Viel zwiespältiger zeigt sich indes die jüngere Generation. » Kelela betont, dass ihr Körper für den Betrachter virtuell bleibt«, schrieb Philipp Kunze an dieser Stelle in seinem Essay zu ihrem Video »A Message« . Ähnlich FKA Twigs’ Video zu »M3LL155X« in welchem sie als aufblasbare Gummipuppe dem male gaze begegnet. Indem sich die Körper verflüssigen und völlig entäußern, treffen sie essentielle Selbstaussagen, die nicht selten allgemeine Verhältnisse auf den Punkt bringen. Twigs allerdings ging noch einen Schritt weiter und inszenierte einen Werbefilm für Google Glasses als Kunstprojekt – oder umgekehrt? Der Unterschied liegt in der (Körper-)Haltung: Die Björk-Mutantin auf dem »Vulnicura«-Cover steht aufrecht und konfrontativ da, das Cover von »M3LL155X« trifft zwischen Abwehrhaltung und Selbstaufgabe keine Entscheidung. Ein paradoxes peekaboo: Ihr könnt mich zwar an- und sogar durch mich hindurchsehen, ihr seht mich aber nicht.Ihr könnt mich zwar an- und sogar durch mich hindurchsehen, ihr seht mich aber nicht.
Noch schwieriger wurde die Frage der Haltung beim Kollektiv PC Music. Während auf der einen Seite stilisierte Figuren wie QT schon per Namen auf so wenig Speicherplatz wie nur irgend möglich zusammengestaucht werden, ist die Musik kaum mehr als der Jingle für die hauseigene Merch-Abteilung. QT ist weniger Mensch oder Musikprojekt als vielmehr Maskottchen des eigenen Energiedrinks SOPHIE veröffentlichte sein Debütalbum »Product« statt rein als immateriellen Datei-Download gleich als Produktpalette, deren Angebot – das u.a. einen im eleganten Schwarz gehaltenen Doppeldildo enthielt – angeblich sofort ausverkauft war. Der Clou: Derweil PC Music das Artifizielle und Abstrakte zelebrieren, ist das immer an sehr echte Dinge gebunden, von denen zumindest einige erhältlich waren, wie etwa der Energy Drink Bei anderen wiederum handelt es sich um genau das, was dem Meta-Genre Vaporwave seinen Namen verlieh: Vaporware Objekte, die zwar existieren – allerdings nur in der Theorie. Hauptsache, ein Fetisch wird getriggert.
Dass PC Music eigentlich ein großer Marketing-Coup von Red Bull seien, bestritten SOPHIE und A. G. Cook ausgerechnet gegenüber dem Authentizitäts-vernarrten Rolling Stone unter der vielsagenden Headline »PC Music Are for Real«. For real sind sie in ihrer Begeisterung für ihr Tun genauso wie Post Malone, wie bei dem kann die Überdosis von Codes den Kapitalismus jedoch höchstens spiegeln, nicht aber ihn kritisieren. Deutlich wurde das in der Kollaboration von PC Music und dem Major-Label Columbia Der Generalvorwurf des Ausverkaufs wurde 2015 kaum noch erhoben, im Falle von PC Music wäre das sowieso müßig gewesen: Ausverkauf ist bei ihnen zum erklärten (künstlerischen) Ziel geworden.
Wie kann eine authentische, echte Haltung noch klingen oder aussehen? Brauchen wir vielleicht doch wieder Protestsongs? Sollten wir uns nicht vereinnahmen lassen? Das sind Fragen, über die Daniel Lopatin aka Oneohtrix Pointer Never in unserem Interview nur müde schnaufte Lopatin schert sich einen Scheiß drum, ob ihn jemand wegen seiner Verbindungen zu Red Bull kritisieren könnte. Mit seinem diesjährig erschienenen Album »Garden Of Delete« stellt er außerdem den Mythos vom rebellischen Ausbund von Authentizität in Frage: Grunge wird von Lopatin als fabrizierte Lüge enttarnt, die solange wiederholt wurde, bis sie fester Teil der Realität wurde. Er will die Lüge zurückerobern, um sie zu enttarnen. Das ist die Zuspitzung dessen, worum es bisher ging: Das Inauthentische wird dermaßen überzogen, dass es wieder zum Spektakel wird. Letterman soll wieder ein erregtes »Buddy, come on!« schreien, statt gütlich »There you go!« zu brummen.
Wo Lopatin sich zynischer Manipulation hingibt, versucht Holly Herndon es anders anzugehen. Als »Trägersignal« also eine Art trojanisches Pferd, versteht sie ihre Musik und fungiert selbst als solches: Obwohl ihr Gesicht auf dem Cover zu sehen und von außen allein ihr Name auf ihrem zweiten Album »Platform« zu lesen ist, verweist die Platte über zahlreiche Features auf eine Vielzahl anderer Personen und Ideen. Eine positiv formulierte Antwort auf die Übervernetztheit unserer Tage und nichtsdestotrotz eine Haltung. Eine, die das Gute zu sehen oder besser noch sichtbar zu machen versucht. Unecht wirkt das höchstens, weil wir von Realität meistens dann sprechen, wenn wir von den schlimmen Dingen des Lebens reden.
Haltung nahm Holly Herndon auch im Video zu »Home« ein, das ähnlich nah am Exzess operiert wie die Future Islands bei Letterman oder »Hotline Bling«: Über sechs Minuten starrt Herndon direkt in die Kamera, setzt sich und vor allem ihrem Publikum einer Überdosis Intimität, soll heißen Authentizität aus. ###CITI:Obwohl es keine (physische) Nähe zwischen uns gibt, meinen wir sie doch zu spüren.:### Wie bei einem Skype-Gespräch allerdings, in welchem sich die Redenden zwar ansehen, nie aber einander in die Augen schauen können. »It feels like you see me«, singt sie, »When you look at me/You’re somewhere else« Kelela. Das ist die (schlimme) Realität der Kommunikation mit Pop-Stars, auf einen Nenner zusammengestrichen: Obwohl es keine (physische) Nähe zwischen uns gibt, meinen wir sie doch zu spüren. »It makes me happy«, sang schließlich auch Post Malone und was ihn da eigentlich glücklich macht, das ist ziemlich egal.
Dem gegenüber aber steht das Verlangen nach Einfachheit und Echtheit, ob es der Analog-Hardware-Fetisch im Techno ist oder der anhaltende Vinyl-Boom, in dessen Rahmen gerne vom »warmen« Sounds des Mediums gesprochen. Warm wie ein lebendiger, echter (Klang-)Körper. Auch die »Lügenpresse«-Schreie des (selbsterklärten) deutschen Packs entspringen der Verzweiflung, keine simplen Antworten mehr zu bekommen, die es in einer komplizierten Welt wie unserer zwar nie gegeben hat, die aber in einer weniger komplexen medialen Situation auf vermeintliche Wahrheiten zugespitzt werden mussten. Propaganda-Blogs, Verschwörungstheorien, obskure YouTube-Kanäle haben deshalb Hochkonjunktur, weil sie genau das versprechen: Simple Antworten mit Wahrheitsanspruch. Zu Kendrick Lamars »What’s your perspective on that?« lassen sich dort reihenweise Repliken finden.
Authentizität mag in unserer kapitalistisch durchdrungenen Gesellschaft eine Währung sein. Pop zeigte uns im letzten Jahr jedoch, dass auf der Rückseite der Medaille kein Wert notiert ist. Es gibt nichts mehr hinter der Maske. Wer bleibt denn nun er selbst – Sebastian Meisinger oder Money Boy? Hatte Diedrich Diederichsen noch 2014 geschrieben, dass es beim Popstar »unentscheidbar [sei], ob der Protagonist eine wirkliche oder eine erfundene Figur ist«, muss das nach 2015 revidiert werden: Wirkliche und erfundene Figur sind miteinander verschmolzen, flüssig geworden. Am Ende der Echtzeit wird das Selbst aufgegeben. Damit erst wieder Aussagen über das Selbst getroffen werden können. Es sind lediglich keine einfachen, simplen Antworten. Weil wir in keiner einfachen, simplen Welt leben.