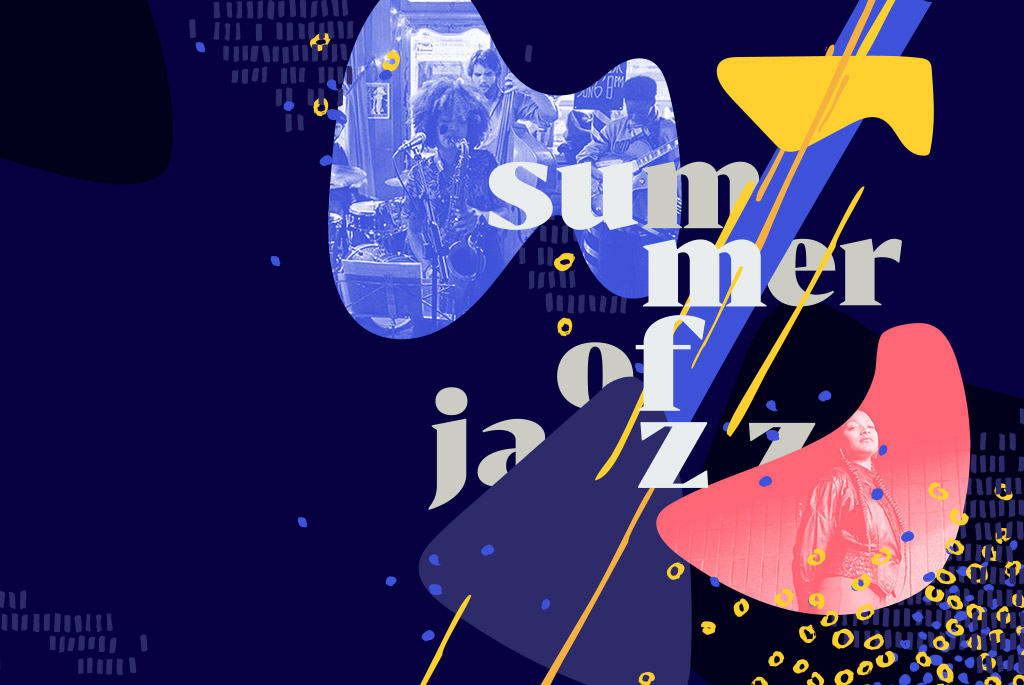Ein Gespenst geht um im Jazz: Sein Name ist Gender Equality. Ende 2018 verabschiedete die UDJ (Union Deutscher Jazzmusiker – ohne Gendersternchen) eine »Gemeinsame Erklärung zur Gleichstellung von Frauen im Jazz«. Besser spät als nie, mag man da denken. Neben Forderungen zur genderneutralen Sprache, zur gerechten Verteilung von Funktionen und Ämtern und zu einer geschlechts-ausgeglichenen Pädagogik, stellt die Erklärung fest, dass auch heute einiges im Argen liegt: »Die Jazzszene ist in Deutschland nach wie vor maßgeblich von Männern geprägt. Frauen machen laut der Jazzstudie 2016 nur ein Fünftel der Jazzmusikerinnen in Deutschland aus. Bei der Verteilung auf die verschiedenen Instrumentengruppen fällt zudem auf, dass nur 12% der Instrumentalistinnen Frauen sind, dafür aber 86% der Sänger*innen.«
Unfassbare Verhältnisse, die da in Deutschland, aber auch im Rest der Welt herrschen. Institutionelle Ungleichbehandlung führt beispielsweise zu vier öffentlichrechtlichen Rundfunk-Big-Bands mit insgesamt zwei (!) Instrumentalistinnen. Das macht etwa 3% der Ensemble-Mitglieder. Es ist also Zeit für eine Jazzvariante des legendären Essays der Kunsthistorikerin Linda Nochlin, das 1971 unter dem Namen »Why Have There Been No Great Women Artists?« publiziert wurde. Hier untersucht Nochlin nicht die individuellen Hindernisse des Aufstiegs von Künstlerinnen, sondern die institutionellen. Grundlegend für eine Untersuchung dieser Art ist sicherlich auch eine Aufstellung der Musikerinnen, die »es geschafft haben«, die nationale oder internationale Aufmerksamkeit und Bedeutung erringen konnten.
Die Geschichte des Jazz ist nämlich keineswegs eine allein männlich-geprägte, wenngleich doch dominierte. Gerade für die frühen Jahre des Jazz ist die Faktenlage extrem dünn. Nur wenige Namen von weiblichen Künstlerinnen sind überliefert, was unter anderem daran liegt, dass viele Marching-Bands (aus denen sich dann die ersten Jazz-Kombos bildeten) eine »all-male-policy« hatten. Dennoch wird bei genauerer Betrachtung schnell klar, dass es trotz dessen auch weibliche Akteurinnen gab. Prominentes Beispiel ist sicherlich Lil Hardin Armstrong, die Ehefrau von Louis Armstrong die als Part der Hot Five virtuos das Piano bespielte. Darüber hinaus gilt sie (laut ihrem Biographen) als eine der wichtigsten Akteur*innen hinter den Kulissen des New Orleans Jazz.
Die Geschichte des Jazz ist nämlich keineswegs eine allein männlich-geprägte, wenngleich doch dominierte.
Weitere bedeutende weibliche Figuren aus den Geburtsstunden des Jazz hat die Geschichtsschreibung dennoch vergessen. Selbst eine Lil Hardin Armstrong ist nur Menschen mit tieferen Kenntnissen bekannt – trotz aller zugeschriebener Bedeutung. Große Stars konnten erst die beiden Sängerinnen Ella Fitzgerald und Billie Holiday rund um das Jahr 1935 werden. Ein genauerer Blick lohnt sich dennoch. Während Blanche Calloway ab 1926 Bandleaderin (die erste vermutlich) von mehreren Swing-Formationen war, begann im gleichen Jahr die Karriere von Mary Lou Williams. Williams darf gerne als Wunderkind gelten. Schon mit drei lernte sie das Klavierspiel, mit sechs trat sie das erste Mal auf und mit 16 Jahren tourte sie erstmalig mit ihrem Mann »Bearcat« Williams. Doch beinah wäre es nicht so weit gekommen, da es den anderen Mitgliedern der Vaudeville-Gruppe Syncopaters falsch, gar Unrecht, erschien, dass eine Frau in der Band spiele. »Musik ist Handwerk! Und Handwerk ist männlich!« Ausschlaggebendes Argument für ihre Anstellung – so die Legende – soll ihr harter, sehr männlicher Tastenanschlag gewesen sein. Bis zu ihrem Tod 1981 komponierte sie nicht nur über 300 Stücke (interpretiert von allen Größen der Jazz-Geschichte), sondern gilt auch als »Mutter des Be-Bop«, da sie viele Künstler in Harlem in den 1940er und 1950er Jahren – auch finanziell – unterstützte.
All that female jazz
Kommen wir dennoch zurück zu den beiden vorgenannten Grand Dames, Fitzgerald und Holiday. 1935 suchte Drummer und Komponist Chick Webb nach einer Sängerin und entdeckte die 17jährige Ella Fitzgerald bei einem Talentwettbewerb in New York. Eine unvergleichliche Karriere begann, mit Würdigungen auf allen Ebenen. Sie gilt als eine der Erfinder*innen des Scatgesangs und improvisierte über bekannte und bestehende Lieder, was viele ihrer Interpretationen zu Referenzen werden ließ und noch heute – von Beyoncé bis Fatima – vielen Sängerinnen als Vorbild gilt. Während Fitzgerald mit ihrer jugendlichen und dezenten Art als »Streberin« gelten könnte, darf Billie Holiday als »troublemaker« bezeichnet werden. Derweil sollte man Vorsicht mit dem Begriff walten lassen, denn ihre Kindheit war »nicht einfach«, wie man sagt, wenn man nicht aussprechen möchte, dass sie von Armut, Vergewaltigungen und Prostitution geprägt war. Um das alles hinter sich zu lassen, begann sie inspiriert von Bessie Smith (noch so eine Künstlerin; genannt: The Empress of Blues) zu singen. Ihr eigenwilliger Stil, der nicht etwa trotz, sondern gerade wegen seiner naiven, ungeübten Art und der gering geschulten Stimme, etwas ganz Besonderes war, verhalf ihr schnell zu Ruhm.
Was Billie Holiday an Ausbildung vermissen ließ, machte sie mit Soul, Einsatz und – man könnte es so nennen – dem inhärenten Schmerz des Lebens wieder wett. Diesen Schmerz versuchte sie zeitlebens mit Alkohol und Heroin zu betäuben, was erwartungsgemäß scheiterte und erst die Stimme zerstörte und schon bald zum Tode im Jahr 1959 führte. Derweil beeinflusste sie nicht nur Janis Joplin, sondern auch Nina Simone. Nicht nur politisch aktiv in der Bürgerrechtsbewegung, sondern auch als Sängerin und Pianistin anerkannt, ist Simone heute eine der bekanntesten Künstlerinnen ihrer Zeit. Das war derweil nicht immer so. Erst in den Neunzigern errang sie ihren Weltruhm, bis dahin galt sie vielen (weißen) Männern in den Vorstandetagen als zu eigenwillig, dickköpfig und schwierig. Schon früh orientierte sich Nina Simone weg von den USA, raus in die weite Welt, nach Frankreich und auch Afrika. Hier wurde sie gefeiert, verehrt und geehrt.
Hier zeigt sich das Ungleichgewicht, dass es an »Stimmen« (meint selbstverständlich Vokalistinnen) nicht mangelte, die Instrumentalistinnen aber Mangelware sind. Zwei bekannte Ausnahmen einigten sich, oberflächlich betrachtet, »ausgerechnet« auf das eine, gleiche Instrument: Die Harfe. Sowohl Dorothy Ashby als auch Alice Coltrane nahmen sich des klassischen, europäischen und »weißen« Instruments an. Erstaunen sollte das nicht, da die hergebrachten Jazz-Instrumente (von Trompete bis Schlagwerk), und damit auch Positionen in Bands, meist Männern vorbehalten blieben. Für Alice Coltrane gilt dies gleichsam nur bedingt; sie genoss eine Ausbildung am Jazz-Piano und gerade ihre späteren Werke (viele unter dem spirituellen Namen Turyasangitananda veröffentlicht) sind von Orgel und E-Orgel-Sounds geprägt. Dorothy Ashby hingegen hatte eine verlässliche Beziehung zur Harfe und spezialisierte sich in einem Maße, dass sie bis heute als bedeutenste Harfenist*in des Modern Jazz gelten muss.
Die neue Generationen von Frauen im Jazz sind Teil einer Szene, die sich weitestgehend von männlichem Dominanzgehabe verabschiedet hat.
Dieser kurze geschichtliche Abriss hat nur einige wenige musikalische Positionen aufzeigen können. Interessanterweise waren dennoch alle afro-amerikanisch. In den USA galt Jazz noch lange als Schmuddelkind, das gerade von »weißen« Amerikaner*innen gemieden wurde. Das sollte sich erst mit Fusion- und Smooth-Jazz Ende der 1970er Jahre wirklich ändern. In Europa sah dies bekanntermaßen anders aus. Hier konnten Musikerinnen wie Irène Schweizer, die am Piano (zusätzlich am Schlagzeug) die aufstrebende Free-Jazz-Bewegung schon ab den frühen 1960er Jahren prägte, Joëlle Léandre am Kontrabass und Maggie Nichols als Vokalistin führende Rollen einnehmen. Vor allen Dingen als Mitglieder der Feminist Improvising Group, die sich Ende der 1970er Jahre bildete, konnte feministische Kritik an den patriachalen Strukturen im Allgemeinen und im Jazz im Speziellen mit musikalisch-kultureller Äußerung verbunden werden.
Doch wie sieht es heute aus, muss an dieser Stelle gefragt werden. Gerade aus der derzeitigen Jazz-Hochburg London kommen viele Musikerinnen, die in den letzter Zeit Aufsehen erregt haben. Seien es die Tenorsaxophonistin Nubya Garcia, die Trompeterin und Kokoroko-Bandleaderin Sheila Maurice-Grey , die Gitarristin Shirley Tetteh (alle drei sind auch Mitglieder bei Nèrija) oder die Trompeterin und Flügelhornistin Yazz Ahmed; alle eint, dass sie nicht nur als hervorragende Musikerinnen und Instrumentalistinnen auftreten, sondern neben ihrer weiblichen Position auch ihre interkulturelle, migrantische Identität ins Jazz-Spiel einbringen. Afro-Atlantisch, Arabisch oder Nigerianisch UND weiblich – beides wird mit Stolz vertreten. Sie sind gleichsam Kinder einer (Ost-)Londoner-Szene, die sich weitestgehend von männlichem Dominanzgehabe verabschiedet hat.
Related reviews
Doch auch auf dem europäischen Festland passiert so einiges: die beiden Österreicherinnen Muriel Grossmann und Katharina Ernst sind nur zwei der Künstlerinnen, die man nennen muss. Während Grossmann als Tenorsaxophonistin im Be-Bop und Hard-Bop eines John Coltrane schon etliches Echo hervorgerufen hat, steht Ernst als Solo-Schlagzeugerin für einen unakademischen Avantgarde-Sound, der gekonnt elektroakustische Einflüsse und Jazz verbindet. Das kann natürlich nicht mehr als ein kleiner Einblick in die Geschichte des Jazz aus »weiblicher Perspektive« sein, dennoch können bei näherer Betrachtung etliche strukturelle Hindernisse erkannt und benannt werden, die dafür sorgten und sorgen, dass Jazzmusikerinnen (vor allen Dingen Instrumentalistinnen) bis heute weder den (vermeintlichen) Impact besitzen, noch im selben Maße wie ihre männlichen Kollegen aus monetären Mitteln zehren können. Die Forderungen der UDJ können dementsprechend nur als Mindestforderungen ausgelegt werden; das bringt derweil den »Müttern« des Jazz heute wenig. Eine Beschäftigung mit ihrem Werk sollte aber für jede*n Jazz-Einsteiger*in ein Muss darstellen.
Frauen des Jazz findest du im Webshop bei HHV Records