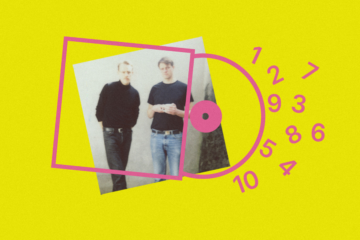Die Geschichte ist schnell erzählt: Der gebürtige Hamburger Hipster Thomas Meinecke kommt nach München, was etwa Ende 70er Jahre geschieht, findet dort Mitstreiter*innen für ein Avantgarde-Kunst-Magazin namens »Mode & Verzweiflung« und formuliert dort folgende markigen Worte: »… und so müssen wir unsere Wachsamkeit in Spiel und Revolte der ständig veränderten Situation anpassen: Heute Disco, morgen Umsturz, übermorgen Landpartie. Dies nennen wir Freiwillige Selbstkontrolle.« Klingt diese situationistische Losung nicht nur top-aktuell, sondern geradezu verlockend? Ständiger Wandel, Hedonismus und Aktivismus finden heute ohnehin auf jedem zweiten Wald-und-Wiesen-Festival zusammen und gegen Disco kann man wirklich nichts haben, oder?
Die fortwährende Aktualität ist charakteristisch für das selbsternannte »Mode & Verzweiflung-Produkt«, aus der eben zitierten Maxime wächst 1980 in Folge eine kleine New Wave-Band mit Postpunk-Ethos, die neben Meinecke vorerst aus der Künstlerin Michaela Melián, dem heutigen Kurator und Direktor des Wolfsburger Kunstvereins, Justin Hoffmann und dem Fotografen Wilfried Petzi besteht. Und einer kleinen Drummachine, die den Mangel an einem echten Schlagzeuger mal besser, mal schlechter verwaltet.
Eine erste self-titled EP, eine zweite (»Teilnehmende Beobachtung«) und ein Album (»Stürmer«) später, sind sie zwar irgendwie Part der Neuen Deutschen Welle, gehen aber nie in ihr auf und widerstehen den Verlockungen der großen Plattenfirmen. Stattdessen entwickelt sich die Freiwillige Selbstkontrolle in ungeahnte Richtungen: Plötzlich tauchen volksmusikalische Klänge auf, zeitgleich kommen transatlantisch vermittelte Polkas und Country-Songs auf, später fast-instrumentale Leftfield-Popsongs.
»Das ist ja der Punkt, der uns verbindet: Dass wir wissen, was man weglässt.«
Michaela Melián
Irgendwo dazwischen wird man nicht nur zu einer der Lieblingsbands der englischen Radio-DJ-Ikone John Peel, sondern holt sich mit Carl Oesterhelt einen echten, richtigen Drummer an Bord. In den Nuller Jahren erforscht man das dritte (oder vierte) Disco-Revival, lässt sich von der Detroiter House-Legende Anthony Shakir durchschütteln und remixen und übt sich in Diskurspop. Einer, der eben nicht nach Hamburger Schule klingt, sondern eigenartig groovet und stolpert und den Feuilletons dieser Welt gefällt.
Naja, so schnell ist das alles gar nicht erzählt, wenn man ehrlich ist. 44 Jahre Bandbestehen haben eben doch seine Spuren hinterlassen, jedoch nur in unerheblichem Ausmaß an den Musiker*innen selbst. Wir sprachen mit der Band am Rande des Meakusma Festivals, auf dem sie gastierten, über die Geschichte, das Geheimnis des langen Zusammenbleibens und beweisen dabei, wie wichtig eine gelebte Streitkultur ist.
Laut eurem Gründungsmanifest aus der Zeitung »Mode & Verzweiflung« ist die Freiwillige Selbstkontrolle eine, die sich als Anpassungsfähigkeit an die jeweils aktuellen Zustände definiert. Welches ist denn die letzte Anpassung, die ihr als Band gemacht habt?
Justin Hoffmann: Wenn ich die neue Platte »Topsy-Turvy« mit anderen Platten von uns vergleiche, steht nicht mehr der Song im Vordergrund, sondern eine jazzige Herangehensweise des Spielens. Das wäre sowas wie eine Anpassung an unsere eigenen, veränderten Hörgewohnheiten.
Thomas Meinecke: Es gibt dieses schöne Wort »Jazz-Informed«. Das sagt, dass wir viel Jazz hören, aber dann bloß nicht den Irrtum daraus ableiten, jetzt auch Jazz spielen zu wollen oder zu können. Dass man aber denkt: »Jazz is the teacher«, was ja auch ein Begriff ist, der im Techno aufkam. Bei uns hat sich immer niedergeschlagen, was wir hören.
Michaela Melián: Diese mobile Anpassung, nach der du gefragt hast, die ist ein fließender Prozess, wo permanent was Neues dazukommt, während etwas anderes temporär unwichtiger wird. Das verschwindet aber nie, sondern kann jederzeit wieder größere Bedeutung für uns haben. Wir orientieren uns da nicht an Trends, sondern an unserer eigenen Idee einer Band.
Ist es das, was zuerst Hermann Hesse und, in Anlehnung daran, Siegfried Lenz als »selbstgewähltes Abseitsstehen« bezeichnen? Also nie in den Mittelpunkt vordringen wollen, sondern immer von der Randposition reingucken, was da passiert?
Michaela Melián: In den Anfangstagen hieß ein Credo von uns: »Teilnehmende Beobachtung«. Das funktioniert aber nur, wenn man nicht nur schaut, sondern auch teilnimmt und seinen eigenen Saft in die Maschine gießt.
Carl Oesterhelt: Ich habe manchmal Probleme, wenn andere – oder auch wir – sagen, es sei »informed«. Wir sprechen trotzdem nur von einem ganz kleinen Ausschnitt, auf den wir uns beziehen. Es gibt so dermaßen viel, von dem man sich eigentlich beeinflussen lassen könnte. Also informed müsste teilinformed heißen.
Michaela Melián: Aber das ist ja der Punkt, der uns verbindet: Dass wir wissen, was man weglässt. Das ist ohnehin die Diskussion, auf deren Basis wir auch unsere Stücke entwickeln. Man könnte immer viel mehr spielen und viel mehr adaptieren. Aber du hast ja recht: Das Wort »informed« ist ein ganz großes Wort, irgendwie.
Thomas Meinecke: »Halbwissen rules«, in meinem Leben auf jeden Fall. Gerade Jazz, wenn wir dabeibleiben, ist ja eine Musik, die auch von »to dig« kommt. Eine typische Frage im Jazz ist: »Do you dig that?« Also ungefähr »Schnallst du es?« – auch wenn ich das Wort nicht mag. Da geht es nicht um wissen, sondern um verstehen und fühlen, um Begreifen.
Kommen wir mal weg vom Jazz und beziehen uns mal auf die Achtziger, die ja den (pop-)kulturellen Hintergrund Eurer Bandwerdung darstellen. Jetzt muss man natürlich feststellen, dass sich in diesen 40 Jahren einiges getan hat, wir nämlich von einem Fernsehzeitalter im Internet- und Social-Media-Zeitalter gelandet sind. Habt ihr das jetzt zum 40. Bandjubiläum nochmal reflektiert? Oder war das alles Teil des ausgiebig begangenen 30. Jubiläums, zu dem ihr auch eine Compilation veröffentlicht habt?
Justin Hoffmann: Das war das Label, das es begangen hat. Wir waren nie so Jubiläumstypen.
Michaela Melián: Die Reflexion geschieht bei uns eher als Debatte darüber, welche Songs man in ein Konzertset übernimmt. Dass wir uns fragen, auf welches Jahrzehnt man sich fokussiert. Das ist bei uns oftmals sehr heterogen – das Material, aber auch unsere Meinung, was mal wieder gespielt werden sollte.
Thomas Meinecke: Wir haben an die 300 Stücke und wir können live jedes Mal nur ungefähr zwölf davon spielen. Da muss man aussieben. Manchmal geschieht das aus inhaltlichen Gründen: Ein Song wie z.B. »Flagge verbrennen, Regierung ertränken« haben wir immer sehr gerne gespielt. Wir sind nie auf die Idee gekommen, dass der Song eventuell Applaus von den Falschen kriegen würde. Oder unsere Polkas: Die waren ja Teil einer Forschung zur Auswandererkultur im 19. Jahrhundert, als hybride Formen der Musik in den USA entstanden. Wo aber der Bayerische Rundfunk sein Programm unter »Heimat-Sound« laufen lässt – wo ich überhaupt nicht weiß, was das sein soll – kann man nichts mehr spielen, das irgendwie als volkstümelnd falsch interpretiert werden könnte.
»Alleine am Laptop, da fehlt der Widerstand, das Gestörtwerden im eigenen Gedankenfluß. Das ist heute wichtiger denn je.«
Wilfried Petzi
Was sich auch grundlegend geändert hat: Die Band, die Musikgruppe mit mehr als zwei Musiker:innen droht auszusterben. Es gibt kaum mehr Bands, sondern vor allen Dingen Soloprojekte, temporäre Kooperationen und es gibt Duos. Ihr haltet hingegen seit über 40 Jahren am Format »Band« fest. Könnt ihr ein Plädoyer auf »die Band« halten?
Michaela Melián: Die Band ist ein Forschungsinstrument, ein Labor, in dem man zusammenarbeitet, wo man sonst auf sich selbst zurückgeworfen ist. Vor allen Dingen wir als FSK, die wir alle eigene Erfahrungen gemacht haben, kommen dann zusammen, um uns auszutauschen – und sich auch immer wieder aneinander zu reiben und zu diskutieren.
Es gibt diese ganzen Gründe, warum so wenige den Weg in die Band suchen: dass man kaum mehr Gagen bekommt, die ausreichen; dass es überhaupt die ganzen Auftrittsorte gar nicht mehr gibt, wo man mit fünf Personen einfach mal auftritt.
Justin Hoffmann: Die Produktionsbedingungen haben sich natürlich auch geändert. Der tragbare Computer und die Sampler, die entwickelt wurden – das sind ja auch Errungenschaften. Dagegen wirkt Instrumente wie Gitarre oder Schlagzeug kaufen und sich wöchentlich zur Bandprobe verabreden einfach antiquiert.
Wilfried, du hast mir vor zehn Jahren nach einem Konzert mal den Tipp gegeben: »Lern ein Instrument und spiel mit den anderen Leuten zusammen, denn es gibt nichts Schöneres.«
Wilfried Petzi: Genau. Das ist nach wie vor, glaube ich, so. Da haben wir gestern auch drüber geredet, wie toll diese Form »Band« ist. Da haben wir uns Devon Rexi angehört. Junge Menschen, die sich anscheinend doch wieder für die Musikgruppe entschieden haben. Alleine am Laptop, da fehlt der Widerstand, das Gestörtwerden im eigenen Gedankenfluß. Das ist heute wichtiger denn je.
Carl Oesterhelt: Die Band ist das einzige Konstrukt sozusagen, wo quasi nicht einer alleine komponiert. In einer Band musst du immer wieder akzeptieren, was nicht aus deinem Gehirn kommt. Das ist für mich die Idealform der zwischenmenschlichen Beziehung.
Bei dir, Carl, ist die Bewegung ja eine, die immer wieder zwischen Solo-Komposition und Bandgefüge oszilliert. Du bist Teil von FSK, warst bei den Merricks und im Tied & Tickled Trio. Gleichzeitig hast du bereits ab 2000 dein Projekt Carlo Fashion und nun veröffentlichst du regelmäßig auf dem mexikanischen Label Umor Rex – echt tolle Platten, die es auch im HHV Shop zu bestellen gibt. Wie kam es zu diesem Engagement?
Carl Oesterhelt: Ja, das war ein totaler Glücksfall. Ich hatte eine Synthesizer-Platte aufgenommen, eigentlich für das 2007 dann eingestellte Hausmusik-Label. Und der Mexikaner kannte meine Platten, weil er beim gleichen Vertrieb ist wie Hausmusik: Morr Music. Dann sprach er mich an und suchte sich von der Platte elf Stücke raus: »Eleven Pieces for Synthesizer« hieß das Ergebnis. Als nächstes kam eben mein alter Bandkollege Andreas Gerth auf mich zu und meinte: »Wenn da jetzt eine Platte von dir kommt, dann machen wir jetzt nochmal etwas zusammen.« So war der schon immer. Und mit ihm produziere ich jetzt, wie man das so bei »modernem Scheiß« macht: Zwischen Berlin und München, remote, und basteln da unsere Tracks. Und die erscheinen auch bei Umor Rex – und das klappt sehr gut.
Related reviews
Es gibt diese verschiedenen Professionen, die ihr alle verfolgt: Musiker:in, Fotograf, Leiter des Kunstvereins in Wolfsburg, Schriftsteller, bildende Künstlerin und Professorin. Ich habe mich gefragt, ob diese anderen Facetten, dieses Ausleben von vielleicht auch eben singulären Ambitionen, gleichzeitig erfolgversprechend ist für die Band und ihr langes Fortbestehen.
Thomas Meinecke: In den Anfangstagen war es maßgeblich, dass wir alle auch andere Facetten in unserem Leben hatten. Da hätte ohnehin keiner gedacht, dass das eine langlebige Angelegenheit wird. Da wollte man einfach eine Platte machen. Dann kam aber der New Wave/Neue Deutsche Welle-Boom – und die Leute fragten, ob wir nicht auftreten können. Plötzlich war da also eine Band innerhalb kurzer Zeit gewachsen, mit allem drum und dran. Aber trotzdem haben wir uns dann dafür entschieden unseren eigenen, speziellen Weg zu gehen – und das gleiche gilt für jedes der fünf Mitglieder von FSK. Die Unabhängigkeit, die uns das nicht vollkommene Aufgehen in der Band geschaffen hat, eröffnete dann wiederum Möglichkeiten Haken zu schlagen und Entscheidungen zu treffen, die andere so nicht hätten treffen können. Dennoch: Wir sind keine Hobby-Band, die das so nebenbei macht. Es gibt da eine vollkommene Leidenschaft, so zu spielen, als wenn man davon leben könnte und müsste.