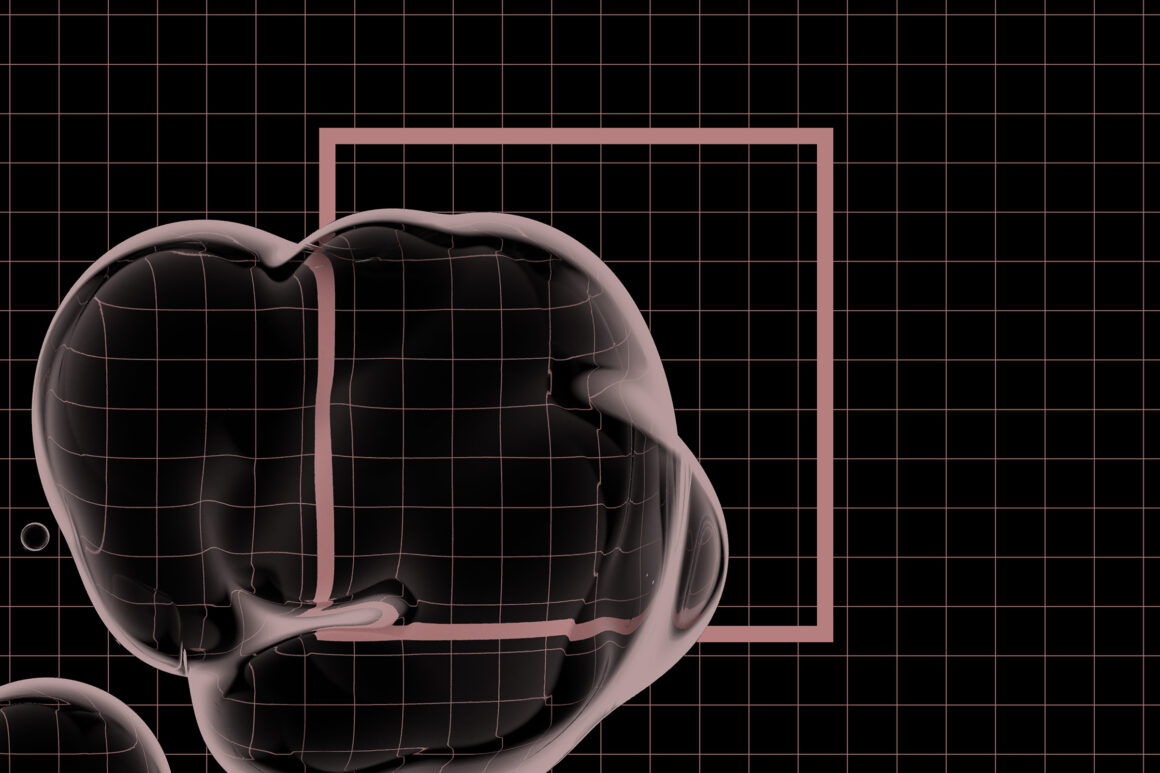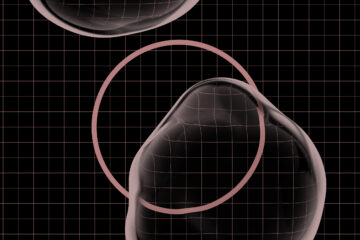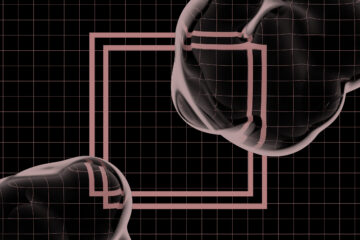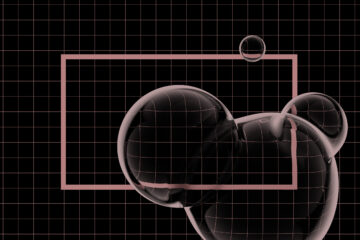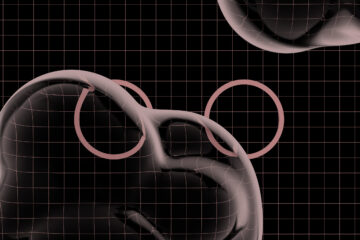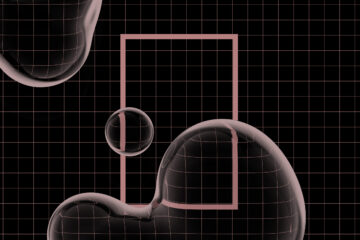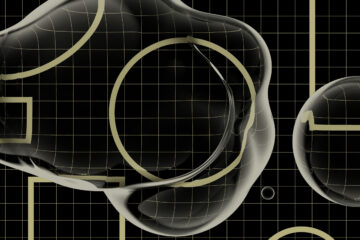Auf einer Skala von 1 bis #8ACE00, wie brat war euer summer? Unserer, das könnt ihr an unserer Auswahl der uns 50 liebsten Alben aus dem Jahr 2024 ablesen, war eher very demure, very mindful. Ob nun »Bauch, Beine, Po« oder »It’s that me espresso«: Mainstream-Pop produzierte in diesem Jahr mehr Memes als eindrückliche Momente und das Album-Game scheint mittlerweile komplett durchgespielt. Es gab mehr interessante Thinkpieces zu »Cowboy Carter« zu lesen als spannende Songs auf diesem Album zu hören.
Zugegeben: Blockbuster-Pop stellt sowieso nur ausnahmsweise den Soundtrack unseres – und, so glauben wir, eures – Lebens dar. Der Pop, der uns am ehesten auf Reisen mitnimmt, kommt von Arooj Aftab, Astrid Sonne, Julia Holter oder Marie Klock sowie natürlich Beth Gibbons, deren Comeback das wirklich Beste ist, was uns das Trip-Hop-Revival der vergangenen Jahre – also, neben der neuen Jabu-LP – beschert hat. À propos Comeback: Für das erste The-Cure-Album seit 16 fucking Jahren hatten wir unter den – übrigens alphabetisch geordneten – 50 besten Schallplatten des Jahres natürlich ebenfalls einen Platz frei.
Zwischen brat summer und Metamoderne
Mehr noch als im Pop liegen unsere Kernkompetenzen ja sowieso im Hip-Hop. Denzel Curry, Earl Sweatshirt & The Alchemist und Vince Staples machten in der Hinsicht 2024 zu einem erfolgreichen Jahr, aber auch… Ja, auch die ehemalige Sonic-Youth-Bassistin Kim Gordon setzte im mittleren BPM-Bereich Impulse. Unwahrscheinliches ist uns sowieso am liebsten, weshalb bei uns neben einiger Konsensplatten – Cindy Lee im Rockbereich, Thou im Metal oder Loidis als die beste Techno-Platte aus dem Jahr 2004 des Jahres 2024, Nala Sinephro sowieso – vor allem die randständigen Alben auf dem Plattenteller landeten.
Brokenchords sonderbares Stilgemisch, die Orgel-/Vocal-Experimente von Fuji||||||||||Ta, Garth Erasmus’ Trauerlieder, die Kollaboration von Sam Shackleton mit Holy Tongue, Klara Lewis’ Abschied von Peter Rehberg, Rosa Anschütz’ metamoderne Kunstlieder oder Zelienoples Slowcore-Post-Rock: Dieses Jahr hatte musikalisch so viel mehr zu bieten als nur den brat summer oder »Espresso«-Schlürfen über 1980er-Funk. Es gab so viele Schätze, die wir bergen konnten – und die wir unbedingt mit euch teilen möchten. Kristoffer Cornils

Viele Ambient-Alben sind in diesem Jahr erschienen, »Other Rooms« ist das beste. Der Belgier Adriaan de Roover schiebt uns vor die Türen von sieben sehr unterschiedlichen Räumen, öffnet sie immer nur einen Spalt breit, gewährt uns einen kurzen, insgesamt nur 30-minütigen Blick in Welten, die ein Zen-Garten sind, eine Kunstgalerie, die Ruine einer eingestürzten Lagerhalle aus rostigem Stahl und zerbrochenem Glas, ein Straßenmarkt in Indien. Eine Tür ist verschlossen, dahinter ein Club. Du stehst davor, spürst den Vibe, ahnst die Bässe.
Sebastian Hinz Zur Review
Adrianne Lenker könnte auch den Beipackzettel einer Kopfschmerztablette vertonen und es würde einem vermutlich fast das Herz zerreißen. Nun sind die Themen auf »Bright Future« auf eine andere Art aus dem Leben gegriffen – Lenker erinnert sich an den verstorbenen Hund aus Kindertagen und Liebesenttäuschungen, als würde sie aus ihrem Tagebuch vorlesen. Und obwohl da von einer gewissen »Sadness as a gift« die Rede ist, spendet eben jene den nötigen Trost, wenn der Weltschmerz doch mal wieder etwas schwerer wiegt.
Laura Kunkel Zur Review
Bereits 2002 präsentierten die beiden in Los Angeles lebenden Jeremiah Chiu und Marta Sofia Honer auf »Recordings from the Åland Islands« eine hybride Musik, die die Welt als Ganzes umarmt. In diesem Jahr haben sie folgerichtig Ariel Kalma, den Hohepriester der meditativen New-Age-Musik, mit ins Boot geholt und mit »The Closest Thing To Silence« Musik eingespielt, die sich wirklich nichts mehr verweigert, sondern ergebnisoffen treiben lässt und dazu einlädt, die Schönheit in den Dingen schlicht anzuerkennen.
Sebastian Hinz
Eins steht fest, Aroma Nice ist Junglist of the year, mindestens. Nicht nur, dass er mit der nur digital veröffentlichten »Cycling Into Oncoming Traffic« (Yuku) ganz programmatisch Atmosphäre, Adrenalin und Intensität zu vier Diamanten verdichtet. Auf dem Vinyl-Minialbum »Old Haunts« (Yuku) öffnet sich ein hochgravitatorischer Strudel nach dem anderen. Verspinnert wie Squarepusher, atmosphärisch wie Amon Tobin und brachial wie Ruby My Dear, ohne je in die ausgetretenen 1993-Schablonen zu verfallen, die so viele Jungle-Veröffentlichungen derzeit ausmachen.
Jens Pacholsky
»Night Reign«, das vierte Album von Arooj Aftab, liefert den perfekt sinistren Sound für die erste Jahreshälfte. Die Platte trägt nicht nur durch die Nacht, sondern durch Frühdienste, durch verkaterte Sonntage, begleitet beim Doomscrolling, geleitet durchs Wochenende am See und kommt kuscheln auf der Couch. »Night Reign« paart die Schwere des Vorgängers »Vulture Prince« mit einem Hauch von Leichtigkeit.
Nikta Vahid-Moghtada
Astrid Sonne singt! Die dänische Komponistin und Viola-Spielerin war bisher für instrumentale Experimente bekannt. Auf »Great Doubt« ist vieles anders, nicht nur der Sprechgesang. In ihrem folky, semi-elektronischen R’n’B lässt Sonne die Erkenntnisse aus ihren elektro-akustischen Experimenten in skelettierte, aber vielfarbige Arrangements einfließen. Und die sind viel mehr sind als gesungene Worte mit musikalischer Begleitung. Ob man das dann TripHop, Avant-Pop oder Singer/Songwriter nennt, ist: egal.
Albert Koch
Während ich diese Zeilen schreibe, verkündet der Berliner Senat eklatante Haushaltskürzungen für das kommende Jahr 2025, die die Kulturszene der Stadt hart treffen werden. Schwierig ist das, weil Kultur offen gesagt das Einzige ist, was Berlin noch »sexy« macht. Warum steht das hier? Weil »Dessus Oben Alto Up« in Berlin entstanden ist, weil Andrea Belfi aus Italien und Jules Reidy aus Australien hier eine inspirierende kulturelle Heimat gefunden haben. An Orten, die der Begegnung und dem Austausch dienen, die Kreativität ermöglichen und nicht gewinnorientiert sind. Kultur braucht Nährboden. Doch von der Politik zur Musik. Denn darum steht die Platte in dieser Jahresliste. Eine Musik, die einfach und gleichermaßen kompliziert ist: Belfi spielt vertrackte Rhythmen am Schlagzeug, Reidy schichtet Gitarrensounds. Beide wissen mit ihren Instrumenten umzugehen. Sie bezeichnen sich selbst als »Post-Rock Jam Duo«. Supergut.
Sebastian Hinz Zur Review
Mit »Lives Outgrown« veröffentlichte Beth Gibbons ihr erstes Solo-Album. (Dreißig Jahre nach dem ersten Aufschlag ihrer Band Portishead.) Auf zehn Songs erdet Gibbons hier ihre Stimme mit einem schweren wie unaufgeregten, meist organischen Sound. Große Momente der Katharsis fehlen weitgehend, dafür reinigt die Platte im Ganzen das Seelenleben von Künstlerin wie Publikum. Ein wunderschönes Gefühlsalbum für Kopfmenschen.
Björn Bischoff Zur Review
Ein Song der Post-Hardcore-Band Lungfish als Schlaflied? Gitarrist Nathan Salsburg hat es mit seiner Tochter getestet. Salsburg kann »The Evidence« mit einer Hand spielen und mit der anderen sein Kind halten, bis es eingeschlafen ist. Auf dem Album wird »The Evidence« zu einem fast 20-minütigen, ruckelfrei dahingleitenden Mantra. Dank Salsburgs simplen Spiel auf der akustischen Gitarre, dem brüchigen Gesang von Will Oldham alias Bonnie »Prince« Billy und der zarten Percussion von Tyler Trotter. Gleiches gilt für den Lungfish-Song »Hear The Children Sing« auf Seite 2. Wenn es so etwas wie Folk-Ambient gibt, das ist es.
Albert Koch
Ernestas Kausylas macht Musik, die schwer zu greifen und deshalb fast überall anschlussfähig ist. Einiges auf seinem Zweitwerk als Brokenchord klingt, als sei es nach vierzig Jahren auf einem japanischen Dachboden gefunden worden, während der Opener von »Stone Island Tracks« sich genauso als neue Einlaufhymne vor einem Khruangbin-Konzert empfiehlt. Dem Litauer gelingt Beatmaking, das Hip-Hop-Heads mit Krautrock-Kläusen versöhnen würde, industrielles Understatement mit warmer Psychedelik vereint. Dazu lässt sich chillen und studieren, aber auch mit dem Arsch wackeln und Schnäpse trinken.
Kristoffer Cornils
Im Informationszeitalter ist es schwer, ein Mysterium zu erschaffen – Cindy Lee ist das mit »Diamond Jubilee« gelungen: 32 Songs, zwei Stunden Musik, nur zugänglich über eine obskure Geocities-Seite*. Die Drag Queen mit der blauen Perücke reiht munter Lo-Fi-Hits und sentimentale Love Songs aus einem gespenstischen Parallelkosmos aneinander. Girlbands der 60ies bilden den Kern, aber auch Disco, Psychedelic, cineastische Plastikstreicher, quietschende Synths und vieles mehr wird geboten – alles mit einer ganz eigenen Pop-Sensibilität.
Martin Silbermann Zur Review
Um die Beschränkung der Mittel als Inspiration begreifen zu können, bedarf es heute mehr denn je eines gänzlich eigenen kompositorischen Impetus. Mit Album Nummer drei belegen Australiens inoffizielle Coil-Erben CS + Kreme abermals, dass sie autonomes Sampling und urige Klangfarben über flashy Produktionswerte stellen – und das völlig zurecht. Wer den Zeitgeist hören, schmecken, spüren will, bekommt auf »The Butterfly Drinks The Tears Of The Tortoise« das gegenwärtige Menü abendländischer Schizophrenien in schnörkelig ausstaffierter Grandeur serviert.
Nils Schlechtriemen Zur Review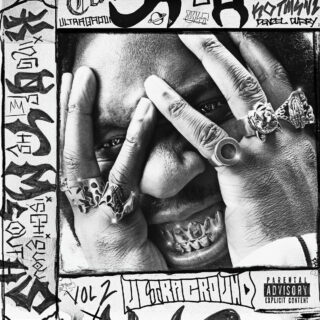
Auch wenn das Memphis-Ding langsam played out ist, war Denzel Currys genealogische Spurensuche auf »KOTMS II« eine Zwischenbilanz in der Karriere eines der wichtigsten Rapper der Dekade. Mit 808s und Cowbells schuf er eine dringliche Reflexion auf Vergangenheit und Jetztzeit der Rap-Landschaft von heute. Gehostet von Kingpin Skinny Pimp versammelte ULT auf dem Quasi-Mixtape Pioniere, Wegbegleiter sowie Aspirat:innen und ließ in dem irren Referenz-Spiel aus 90s-Memphis-Rap und der ersten Soundcloud-Welle alle Atzen wissen, wer der Ultra ist.
Fionn Birr Zur Review
Gerade in Zeiten des viel gescholtenen ADHS-Sounds ist Donato Dozzy wieder en vogue, allerdings als Vertreter einer Gegenbewegung: Ausdauernd, mit der nötigen Ruhe und, ganz wichtig, gutem Geschmack baut er seine Tracks auf. So auch auf »Magda«, auf dem er ebenso routiniert wie eindrucksvoll die alte Erfolgsformel des Techno durchexerziert – Intensität durch fortwährende Wiederholung, Spannung durch graduelle Veränderungen. Psychedelik, Kitsch und Grazie, Dozzy vereint sie noch immer alle.
Maximilian Fritz Zur Review
Earl und Al, das sind Future & Metro Boomin für solche Menschen, die in Birkenstocks Tabak rauchen anstatt in Air Force Ones zu vapen. Das beste Tag-Team im Rap. Gemeinsame Songs haben die beiden schon einige gemacht, zuletzt u.a. das unsterblich gute »Lye«, zu dem man perfekt das Rauchmittel in die Stromlinien des Fahrtwindes legen kann. Jetzt ein gemeinsames Album. »Voire Dire« gönnt eine ganze halbe Stunde der bewährten Rezeptur: Alchemists schleppende, Sample-basierte Beats und Earl Sweatshirts verschachtelte, missmutige Rhymes.
Pippo Kuhzart Zur Review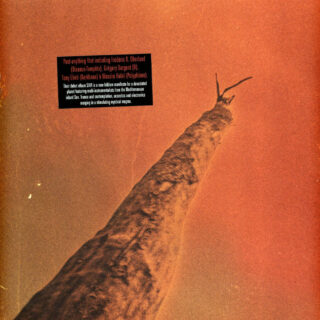
Die 13. Rule of Life lautet: Wenn sich eine Band als »post-everything quartet« bezeichnet, nimm besser gleich die Beine in die Hand. Nur wenn Frédéric D. Oberland (Oiseaux-Tempête), Grégory Dargent, Tony Elieh (Scrambled Eggs) und Wassim Halal dabei sind, bleib wo du bist und übertrag ihnen die volle Kontrolle über deine Extremitäten. »SIHR« erinnert insofern wohl an die Dwarfs of East Agouza, als es – hust, hust – traditionelle Instrumente in einem irgendwie psych-rockigen Setting einsetzt, legt aber mehr Wert auf Drrrrrrrrrrrrrrumsssssssss und ist insgesamt weitaus weiter draußen. Das klingt dann auch mal so, wie GY!BE es mittlerweile tun sollten. 10/10, no notes.
Kristoffer Cornils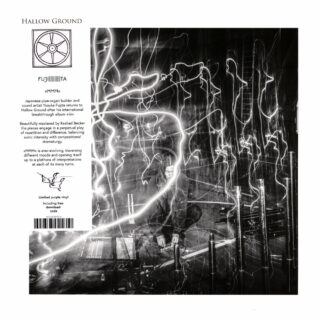
Für sein Album »MMM« hat der japanische Komponist und Klangkünstler Yosuke Fujita seine selbstgebaute Pfeifenorgel mit einer elektrischen Pumpe versehen. Was wie ein technischer Gimmick wirkt, verschafft seiner Musik im wahrsten Sinne des Wortes mehr Luft und lenkt sie in eine neue Richtung. Das über 21-minütige »M-1« als Herzstück des Albums ist gleichzeitig sanft dröhnendes Mantra und Vehikel für mikroskopisch kleine Tonverschiebungen, die dem Instrument ungeahnte rhythmische Möglichkeiten verleihen.
Albert Koch
Garth Erasmus. Nie gehört. Und monatelang den Namen nicht richtig im Kopf gehabt, wenn es darum ging, Freunden zu sagen, dass das hier das Album des Jahres sein könnte. »Threnody for the KhoiSan« ist eins for the ages. Der südafrikanische Sound-Tüftler Erasmus spielt auf teils selbstgebauten Instrumenten eine Art Minimal-Spiritual-Jazz, der irgendwo zwischen Don Cherry und Pierre Bastien seinen Anmut findet.
Pippo Kuhzart
Der große Orgel-Ambient-Hype der letzten Jahre war von großen Gesten geprägt, Hanno Leichtmann jedoch nähert sich einem in der Villa Aurora in Kalifornien ansässigen Instrument mit unnachahmlicher Bescheidenheit. Hin und wieder begleitet von Marimba oder Rohrenglöckchen nimmt er für »Outerlands« dessen Klänge als Ausgangspunkt für wohlig loopende Klangflächen und warme Drones, flechtet preziöse und doch nie prätentiöse Vignetten aus ihnen. Wer den Sonntag statt mit Kali Malone im Kirchenschiff lieber zuhause im Bett verbringt, hat mit diesem Album das ultimative Vaterunser gefunden.
Kristoffer Cornils
Mit atemberaubender Virtuosität beherrscht Hani Mojtahedy ihre Stimme, gleitet mühelos zwischen kristallklarem Sopran und tiefem, kunstvollem Vibrato. Sie singt sowohl auf Persisch als auch auf Kurdisch und reflektiert damit ihre Wurzeln in der Kurdenregion zwischen Iran und Irak. Die melodischen Setar-Klänge, die emotionalen Vocals und die rhythmischen Percussion verschmelzen zu einer kraftvollen, mystischen Einheit. »Hjirok« berührt die Seele und entführt in eine faszinierende Klangwelt, die gleichermaßen von Tradition und Innovation geprägt ist.
Celeste Dittberner Zur Review
Einmal tribale Entrückung mit europäischen Ayahuasca-Analogen, bitte! Dazu gibt es Pangaeische Prosa in glühenden Glossolalien. Holy Tongue und Shackleton kochen ein Süppchen mit weit verzweigter Zutatenliste, das sich von Roberto Musci bis Jon Hassell, von Bill Laswell bis Bryn Jones vielerorts bedient aber wie kein zweites Album tribaler Dub-Musik klingt. Vergesst einfältig kuratierte Playlisten zum Trippen – diese Kombo lockt mit herbstem Stoff in die hazy Hinterzimmer geschundener Seelen.
Nils Schlechtriemen Zur Review
Ein Gunshot knallt den Kinderchor weg, die Gesangsversammlung der Erdmännchen übernimmt pietätslos. Wer Honour ist, wissen wir immer noch nicht ganz. Was wir ganz sicher wissen: So klingt der Urknall, der entsteht, wenn die Soundwelten von Babyfather und … Just Blaze o.ä. aufeinander stoßen würden. Das Resultat ist ein Kosmos mit noch mehr Hall und noch mehr Rauch; Streicher, Snares, übersteuerter Bass und Surf-Gitarren neben 808s. Zu »Àlááfíà« in Track Suits dem Weltuntergang entgegenlaufen und sicher sein, dass er der Gang absolut unterlegen ist.
Pippo Kuhzart
Das Bristol-Trio Jabu schleicht mit trüben Dub-, Trip-Hop- und Dream-Pop-Sounds auf seinem dritten Album durch einen Zeitlupen-Entwurf von R&B, in dem als Videospiel-Referenzen geborene Lyrics plötzlich den Erdboden aufreißen und existenzialistische Themen verhandeln, die perfekt zu dieser Midnight Music passen. Ob man diese gespenstische, in allen Belangen überragende Nebelmusik von »A Soft And Gatherable Star« – in der Stimmen mit verschleppten Beats und in Hall getauchten Gitarren verschmelzen – wirklich bei Tageslicht hören kann, ist noch nicht überliefert.
Christopher Hunold
In London machen sie’s einfach differently. Jawnino bedient sich bei zeitgenössischen Bass-Entwürfen, schreckt nicht vor The-Streets-artigem Storytelling und kitschigen 1980er-Elementen zurück, kennt sich in der Cloud-Rap- und Grime-Historie aus und verquirlt all das auf »40« irgendwie zu einer irrlichternden Mischung. Zu den Feature-Gästen auf diesem Album gehören sowohl MIKE als auch Airhead als Remixer, denn so eine Platte ist das eben: Far-out für die Hip-Hop-Heads und food for thought für alle Ravers, die mit einem mulmigen Gefühl aus der Afterhour stolpern. »Broken Britain / but that's how we like it, innit?« Precisely, mate.
Kristoffer Cornils
Die Verlaufskurve von Jerrilynn Pattons Karriere ist so verschlungen wie die Produktionen der konsequent gutdraufen Künstlerin aus Gary, fucking Indiana. Sowieso, das Björk-Feature stellt keine große Überraschung dar, aber wer hat mit Philip Glass und dem Kronos Quartet auf einer Jlin-Platte gerechnet? Wer es nicht getan hat, muss wohl in der letzten Zeit nicht aufgepasst haben – hier fügen sich nur Dinge, derweil sie anderswo aus den Fugen fliegen. »Akoma« ist dann natürlich genau das Album, das von Patton zu erwarten war: Auch wenn sie ihre Footwork-Wurzeln nicht völlig aufgegeben hat, sind das hier Tracks, aus denen tausend neue Genres entstehen könnten – eines innovativer als das andere.
Kristoffer Cornils
Joanne Robertson und Dean Blunt arbeiten schon fast ein Jahrzehnt eng zusammen. Kein Wunder also, dass ihre sanfte Fusion aus Gitarre und entferntem Gesang auch auf »Backstage Raver« reibungslos funktioniert. In knapp 20 Minuten versammelt sich eine Handvoll Songs in unterschiedlichen Vollständigkeitsstadien – eine Mischung aus schwebenden zweideutigen Emotionen und atmosphärischen Indie-Rock-Elementen. »Backstage Raver« ist ein weiteres Puzzlestück in Dean Blunts musikalischem Kosmos, dessen wahre Größe sich erst offenbart, wenn man sich ihm hingibt.
Moritz Weber
Julia Holter kann Vieles auf »Something In the Room She Moves«. Sie kann mal laut, mal leise, mal düster, mal lieblich, mal minimalistisch und mal opulent. Das sechste Album der Songwriterin aus Los Angeles springt zwischen Synthie und Jazz, mixt Field Recordings mit choralen Arrangements und dreamy Pop mit Avantgarde. »Something In The Room She Moves« ist eines dieser Alben, das ganz viel Aufmerksamkeit braucht und regelrecht einfordert – und es hat sie verrdient.
Nikta Vahid-Moghtada Zur Review
Kim Gordon clasht mit »The Collective« einundsiebzig-jährig ins Jetzt, als stünde sie am Anfang ihrer Sonic Youth Karriere. Gordon sagt zwar zu Anfang des Albums schon »Bye Bye«, meint dabei aber eher ein Ende der Geradlinigkeit von Geschichte. Die Verrücktheit der Gegenwart wird zum Motiv, dass sich durch elf Tracks schlängelt und den Zeitgeist in psychedelische Mantras sublimiert. Nur eine Sache ist für Gordon wahr: Wahrheit gibt es keine mehr. Aber solange es Musik gibt, ist da zumindest noch die Möglichkeit die Realität zum scheppern zu bringen.
Ania Gleich Zur Review
»Thankful« ist bei Klara Lewis kein halbbeliebiger Titel, sondern programmatische Introspektion. Mit dem Album reflektiert die schwedische Komponistin ihre Dankbarkeit gegenüber dem 2021 verstorbenen Editions-Mego-Betreiber und Förderer elektroakustischer Exzentrik, Peter Rehberg. Gleich der Titelsong, der sich vor Rehbergs (alias Pita) »Track 3« verneigt, transportiert eine Arbeits- und Denkweise, die ihm nicht fern gewesen sein kann: dass alles, selbst die Dankbarkeit, über die Zeit Brüche und Risse bekommen und so die Form verändern kann, und dass genau hierin eine beständige Schönheit liegt.
Jana-Maria Mayer Zur Review
»One Day« war genau deshalb eine Sensation, weil nichts daran sensationell klang. Im 160-BPM-TikTok-Edit-Zeitalter stellt Huerco S’ Rückgriff auf dubbigen Minimal Techno und Microhouse unter dem Pseudonym Loidis einen Anachronismus dar, der vielen wie Balsam durch die Gehörgänge ging – ein Antidot gegen Schnelllebigkeit und das Drop-Diktat der letzten Jahre, geboren aus dem Geist der mittleren Nullerjahre. Diese acht Tracks boten Identifikationsfläche für alle, die sich nach simpleren Zeiten und mehr Understatement im Clubzirkus sehnten, ohne das freilich populistisch zu propagieren. Hier macht einer nur, was er will: recht wenig, das aber ungemein effektiv.
Kristoffer Cornils
Lolina erzählt gerne Geschichten. »Unrecognisable«, ein surreales DIY-Konzeptalbum, ist das dritte Kapitel einer fortlaufenden Geschichte, die sich in einer Flut von gekrümmten Stimmen und klapprigen, Dub-verfremdeten Casio-Beats entfaltet. Fast alle Stücke entstanden auf ihrem treuen SK-200, einem Sampling-Keyboard aus dem Jahr 1987. Lolina schlüpft immer wieder in die Rolle zweier Charaktere und verwandelt ihre eigene Stimme durch Tonhöhenverschiebungen und Effekte oft bis zur Unkenntlichkeit. Trotz der fantasievollen Narrative und des perfekt abgestimmten Sounds wirkt das Album am Ende überraschend real und greifbar – näher, als man es erwartet.
Moritz Weber
Marie Klocks Verneigung vor ihrem verstorbenen Dichterfreund Damien Schultz war locker das lebendigste Album des Jahres. Ein unrasiertes Rennen durch die Nacht, alle Betten ungemacht, Kerzenschein und Kritzelgedichte, Anarchie und Hundebellen, »Damien Est Vivant«s stürmischer Neo-Folk-Chanson-Synth-Pop klingt durch und durch nach einer analogen Zeit, in der Interior-Design und gesunde Ernährung dem Erforschen der human condition noch untergeordnet waren.
Pippo Kuhzart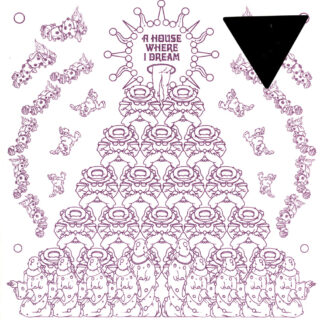
»A House Where I Dream« ist die Auseinandersetzung des belgischen Saxophonisten Mattias De Craene mit »The Holy Mountain«, einem surrealistischen Film von Alejandro Jodorowskys aus dem Jahr 1973. Im Oktober 2024 wurde das Album in Gent uraufgeführt und zusammen mit dem Film live präsentiert. Die Musik funktioniert aber auch ohne Kenntnis des Streifens. De Craene benutzt sein Saxophon und Tape Loops, um hypnotische Schleifen zu kreieren, die Raum und Zeit hinter sich lassen. Auf der A-Seite drängt der Sound mehr ins Transzendentale, die B-Seite setzt auf Ambient-Sounds mit körniger Struktur. Vielleicht so etwas wie der Missing Link zwischen Bendik Giske und William Basinski.
Sebastian Hinz
Nichts Neues unter der Sonne? Die Dinge ändern sich stärker, als man merkt. Auch auf Maya Shenfelds zweitem Album, »Under the Sun«, ist viel los, selbst wenn oft am Rand der Wahrnehmung. Immerhin bringt sie neben den fein schattierten Farben ihrer quecksilbrigen Drone-Elektronik einen Jugendchor und Field Recordings unter, ohne dass sie aus dem Konzept fielen. Dies ist kosmische Musik mit Geist. Und einem Flow, den man ähnlich von Ambient kennt, doch so eher noch nicht schwingen gehört hat.
Tim Caspar Boehme
Nach der »Memotone EP« auf Sähkö im Jahr 2023 und der LP »Tollard«, die Anfang 2024 auf The Trilogy Tapes auf Vinyl erschienen ist, hat Will Yates aka Memotone »Fever of the World« auf Soda Gong nachgelegt. Das Album vergreift sich höchstens im Titel (Album hat max. 36,8°C). Obwohl… die neun Stücke strahlen schon sehr viel Wärme aus, die Memotone mit verschiedenen Produktionstechniken, Sounddesigns und Instrumenten erzeugt. Musik im Geiste von Michel Banabila, Michal Turtle oder Suso Saiz, die zum Innehalten einlädt.
Pippo Kuhzart
Wer die ersten beiden Alben der Londoner Moin als Post Punk bezeichnet hat, sollte einen Schritt weitergehen und »You Never End« unter Post-Post-Punk einsortieren. Das Trio – das Experimental-Elektronik Duo Raime plus Schlagzeugerin Valentina Magaletti – hat jetzt eine Reihe von Gastsänger:innen wie Coby Sey und James K engagiert. Deren Beiträge aber sind so unaufdringlich und flüchtig wie die Musik selbst. Moin operieren in den äußeren Bereichen der Gitarrenmusik, in die sich keine anständige Rocksau vorwagt, sie schaben Indie und Shoegaze bis auf die Knochen ab.
Albert Koch
Gleich zwei große Würfe mit bloß zwei Alben. Muss man dieser Harfenistin erst einmal nachmachen. Nala Sinephros »SPACE 1.8« war 2021 eine Raumvermessung in Sachen Jazz und Ambient, mit »Endlessness« nutzt sie ein Kontinuum aus wenigen Tönen, das sich in geringfügigen Variationen durch die Platte zieht, um die Unendlichkeit in der Wiederholung zu finden. Darüber entfalten sich wie von selbst die Improvisationen. Ruhig bewegt, sehr friedlich. Klingt simpel, ist es auch. Aber eben in genial.
Tim Caspar Boehme Zur Review
»Something here isn’t right« waren seine ersten Worte, wenig später sitzt er weinend im Burger King. Pigbaby hat nach einer unglaublichen EP ein unglaubliches Album nachgelegt, das dem Debüt bezüglich Dringlichkeit und Ausdruckskonzentration in Nichts nachsteht. »i don’t care if anyone listens to this shit once you do« vertont mit simpler Exaktheit die Großstadt-Erfahrung von Kulturinteressierten jungen Erwachsenen mit Mental-Health-Problemen der letzten, mindestens, 30 Jahre: Die Liebe versiegt, die Tage sind grau, nichts kickt wirklich, die Wohnung ist schäbig, Geld fehlt. Und doch bleibt man, scheitert vor sich hin.
Pippo Kuhzart Zur Review
Poeji setzt sich zusammen aus den Namen des Drummers Simon Popp und der Sängerin Enji, die man schon zuvor auch außerhalb der experimentellen Münchner Jazzszene gehört haben dürfte. Für ihr gemeinsames Album-Debüt »Nant« haben sie ihre jeweiligen Haupteinflüsse aus afrikanischer Polyrhythmik und mongolischen Volksliedern gerade so weit zurückgeschraubt, dass eine atmungsaktive Mischung aus Free Jazz und zärtlicher Zeit-Raum-Forschung entstehen konnte. Dass die sehr poetisch klingt, ist wohl in Anbetracht des Namens des Duos auch kein Zufall.
Jana-Maria Mayer Zur Review
Hiermit wäre die Nische Art-School-Dream-Pop in unseren Jahrescharts abgedeckt. Princ€ss greifen das Revival der 2010er vorweg: Die Nonchalance ist groß in diesem hier, im Hintergrund ist genauso viel los wie vorne, der Pop-Song wird höchstens angedeutet, aber immer ganz schnell wieder zurückgezogen. Soll sich bloß niemand zu gemütlich machen. Agitiert greifen wir dann doch ab: Die Dublette aus »Sometimes« und »Hoist Point«; sie gehört zum dem Allerbesten, was dieses Jahr erklungen ist. Das Ganze ein langes Leiern in Richtung Unendlichkeit.
Pippo Kuhzart
Mit »Interior« baut sich Rosa Anschütz ihr Versatzstück musikalischer Geborgenheit: Eine kleine Höhle, in der Verletzlichkeit als Ode an die Vergänglichkeit durch die Gewölbe hallt. So sehr wir uns das Gestern manchmal zurückwünschen, so sehr zeigt uns Anschütz, wie wir es uns auch mit dem Morgen vertrösten können. Dabei taucht die Berliner Künstlerin in ihrem dritten Soloalbum Aphorismen in tiefe Soundbecken und füllt damit das Innenleben mit bittersüßer Melancholie: Zwischen den Tracks zerfließen die Sekunden.
Ania Gleich Zur Review
Als Soela hat die in Berlin lebende Produzentin Elina Shorokhova auf Labels wie E-Beamz, Kompakt und natürlich Dial, wo im Jahr 2020 ihre Debüt-LP erschien, recht ambiente Clubmusik veröffentlicht. Dass sie mit »Dark Portrait« auf dem Frank-&-Tony-Label Scissor and Thread ein Zuhause findet und schon mit dem Opener Konzessionen ans Trip-Hop-Revival macht, überrascht da ebenso wenig wie Gastauftritte von Module One, Lawrence oder Stólar-Gründer Philipp Priebe. Unerwartet kommt da schon eher der Gesang, der allerdings so fein dosiert wird wie jede einzelne Fläche, jede verhaltene Melodie.
Kristoffer Cornils Zur Review
Im Oktober erschien mit »Make It Fit« das erste ordentliche Karate-Album seit 17 Jahren, das beste Karate-Album seit 17 Jahren allerdings hatten Still House Plants bereits im April veröffentlicht. Der Post-Rock des britischen Trios auf »If I don’t make it, I love u« klingt deshalb jazzig, weil eigentlich kaum etwas gerade oder gar zu Ende gespielt und gesungen wird, ist zugleich aber spartanisch wie eine Platte von Moin. Egal, wie viel auf diesen elf Songs passiert, immer scheint etwas zu fehlen, bleibt die Musik so ungemütlich wie ein allein belegtes Doppelbett. Es fällt nicht immer leicht zu sagen, was an diesem chaotischen Durcheinander so bewegend ist – das macht gerade seine Stärke aus.
Kristoffer Cornils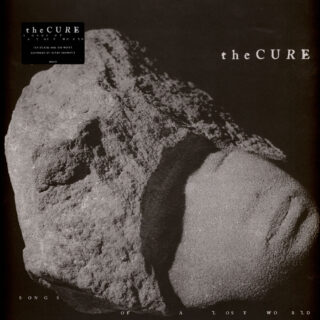
Alles, was die Retromanie-geile Jubelpresse über »Songs Of A Lost World« geschrieben hat, ist wahr. Es ist das beste Album von The Cure seit 35 Jahren. Und es ist der Ausdruck einer erhabenen Melancholie, bei der die jugendlich verklärte Todessehnsucht dem Respekt des Alters vor der eigenen Sterblichkeit weicht. Musikalisch ist das so, als hätte Robert Smith alle seine Alben bis »Disintegration« in den Küchenmixer gegeben und daraus einen bräunlich-grauen Smoothie destilliert, der auch noch gut schmeckt.
Albert Koch Zur Review
Es gibt Musik, mit der man um ein goldenes Kalb tanzen kann. Und es gibt Musik, die klingt, als würde Moses einem den Schädel einschlagen. »Umbilical« ist zweiteres – unheiliger Zorn in Reinform. Die Sludge-Anarchos Thou haben die letzte Dekade die experimentellen Möglichkeiten extremer Musik in die Höhe getrieben. Demgegenüber steigt »Umbilical« mit rasendem Hardcore auf die Erde herab. Das Ergebnis ist die vielleicht konziseste Abreibung des Jahres. Wie in der Bibel steht: Thou Shalt Not Fail!
Michael Zangerl
Junglist Massive, der ist für dich. Tim Reaper (London, UK) und Kloke (Melbourne, Australien) sind innerhalb der neuen Welle des Genres zwei etablierte Namen, entsprechend punktgenau ballert ihr gemeinsames »In Full Effect« den Plack weg. Diese Subbässe werden noch Kindeskinder glücklich machen. Side Fact: Es ist das erste (!) Jungle-Album auf Hyperdub, ein Label, dass pretty much auf dem Geist von Jungle vor ca. 20 Jahren gegründet wurde. Auch deshalb besonders.
Pippo Kuhzart Zur Review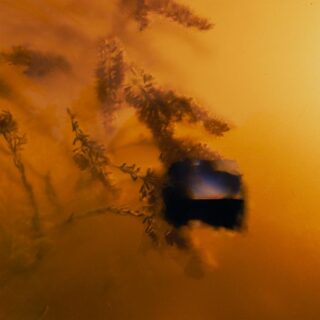
Shoegaze-Gitarrenriffs, einige wenige Subbässe, dazu aufschnellende und gedrückte Vocals reichen aus, eine einnehmende Atmosphäre aufzubauen. »It Means A Lot« von Ulla & Ultrafog erinnert an einen surrealen Sommertraum, an dem die Sonnenstrahlen durch die breite Baumkrone dringen. Gespickt mit einer Mischung aus Gleichgültigkeit und müheloser Souveränität ebnet »It Means A Lot« den Weg für eine neue Art der intimen Musik, die in ihren minimalistischen Facetten nicht vielseitiger sein könnte.
Moritz Weber Zur Review
»Don’t forget to smile« – Vince Staples stand auf »Dark Times« für Unverblümtheit: Herz in der Jugend, Lyrics im Erwachsenenleben. Manche nennen es Seelenstriptease, andere Reality-Rap. Sein Mix aus Westcoast-Sound, BoomBap-Beats und der Erkenntnis, das verletzte innere Kind immer mitzunehmen, zeigt, dass Conscious-Rap nicht mehr preacht, sondern perzipiert – auch dank des Namedroppings von »Below The Heavens«. Alles kein Drama, nur ein bisschen.
Fionn Birr Zur Review
Catherine Backhouse hat mit »Anemones« elf kleine schillernde Blüten in das UK Bass Contiuum gepflanzt. Eigentlich war sie Jahrzehnte als DJ Bunnyhausen für Krautrock und Artverwandtes im mittlerweile geschlossenen Club Kosmische verantwortlich. Als Xylitol erinnert sie sich nun an ihre Jugend in den 1990ern, taucht in ihre Liebe zum Jungle und Hardcore und überschüttet uns auf »Anemones« mit bunten Melodien, ausgelassenen Breaks und melancholische Downbeats. Glücklicherweise gefiel das auch Mike Paradinas, der das Tape-Album auf seinem Label Planet µ auch eine Vinyl-Veröffentlichung schenkte.
Jens Pacholsky
Zelienople, die Band aus Chicago um den ewig fleißigen Matt Christensen, sucht seit mehr als 20 Jahren nach einem Sound, der sich zwischen Drone, Ambient, Slowcore, Post-Rock und Kammer-Jazz bewegt, in dem die Zeit stillsteht und sich Hoffnung und Resignation wie zwei Seiten derselben Medaille anfühlen. »Everything Is Simple« klingt erstmals wirklich nach einer Band. Wenngleich das eine ist, die isoliert voneinander in gigantischen Lagerhallen rhythmische Drumschläge, Vibraphone, Holzbläser und die ein oder andere Gitarre fast wie eine akustische Drohung wirken lässt.
Christopher Hunold