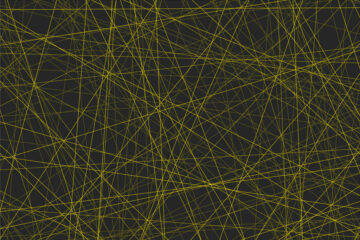David Bowie hält Berlin den Spiegel vor*»Vielleicht ist Bowie vor allem die ideale Figur zur Feuilletonisierung der Subkultur.«
Die Ausstellung im Martin-Gropius-Bau die in London für das Viktoria and Albert Museum konzipiert wurde, huldigt dem großen Schutzheiligen dieser subkulturellen Identität Berlins. »David Bowie hat uns gezeigt, das wir alles sein können, was wir zu sein wünschen«, heißt es gleich eingangs und bemüht um Multimedialität geht es dann mit überdimensionalen Videoleinwänden und synchronisierten Kopfhörern von den frühen Jahren des David Jones bis hin zu jenen Jahren, da dieser als David Bowie für kurze Zeit deckungsgleich mit dieser Stadt zu sein schien. Zu all dem, »was man sein möchte«, gehört in Berlin auch immer die Weltstadt, die man nicht ist und die Provinz, die man überwinden möchte, aber dann doch am liebsten im Kiez bleibt. David Bowie ist dabei die Autorität, die der Stadt in seiner Chamäleonhaftigkeit den Spiegel vorhält und ihr Absolution erteilt, zugleich aber ihre Sehnsucht nach Weltläufigkeit offenbart.
Stattdessen noch mal »Heroes« auflegen
»Bowie likes them, we like them too«, titelte einst der Rolling Stone und hob damit Arcade Fire auf den Popolymp. Die Stadtmagazine und Zeitungen in Deutschland titeln dieser Tage nach einem ähnlichen Schema. Vielleicht ist Bowie vor allem die ideale Figur zur Feuilletonisierung der Subkultur. Seine Botschaften tun nicht mehr weh, sind lange im Mainstream angekommen und an seinem Werk wird die Avantgarde (»Low«, Hansa-Studios, Berlin, 1976) genau so satt wie der Nostalgiker (»Heroes«, Hansa-Studios, Berlin, 1977). Und so wirkt die Ausstellung am Ende sehr bemüht um Lässigkeit und Coolness, versucht sich im ganz großen Format an der Rekonstruktion der Live-Shows und arbeitet sich an der Vielfältigkeit der Kostümierungen ab, und kann doch ihre Bürgerlichkeit nicht verbergen. Es ist wie ein Nachruf auf einen Untoten, ein Scheitern an der Rekonstruktion der endlosen Selbsterfindung des David Jones, das ein schales Gefühl hinterlässt. Wenn man mit dem Gefühl vertraut ist, das sich bei Großkonzerten einstellt, wenn der Sänger auf der Bühne so klein wird, das man sich mit der Videoleinwand zufrieden geben muss und einem im Angesicht der Masse aufgeht, dass Unterhaltungsindustrie und Kunst zwei paar Schuhe sind, dann kann man sich diese Ausstellung eigentlich sparen und stattdessen noch mal »Heroes« auflegen.