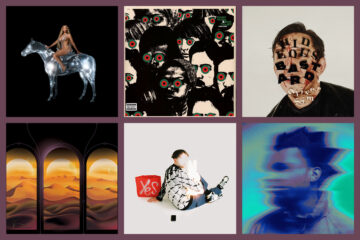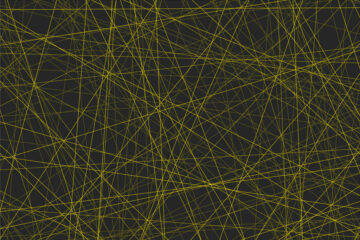Grausam, was in den trüben Gewässern unserer Zeit keine Wellen zu schlagen vermag, sondern sang- und klanglos untergeht. Beyoncé singt in ihrem Video zu »Formation« darüber, sie lässt es in der Halbzeitpause des Super Bowls erklingen. Wichtiger noch: Sie zeigt es. Sie zeigt die drohende Ermächtigung der schwarzen Bevölkerung und die der schwarzen Frau – genauer gesagt der schwarzen Frau aus den Südstaaten der USA. Die Südstaaten, die 2005 vom Hurrikan Katrina überzogen wurden, die keine adäquate Hilfe bekamen. Wobei unterlassene Hilfeleistung nur in erster Instanz zum Vorwurf gereicht. In letzter Instanz lautet der Vorwurf nämlich: Rassismus.
New Orleans ist die schmerzhafteste Erinnerung daran, wie wenig sich die US-amerikanische Politik um die schwarze Bevölkerung schert, auf deren Rücken sie einst ihren Reichtum aufbaute. In New Orleans fängt auch das Video von »Formation« an: Eine in – zumindest augenscheinlich – schlichter Südstaatenmode gekleideten Beyoncé steht ausgerechnet auf einem Polizeiauto und geht langsam mit einem herausfordernden Blick in die Hocke. Die schwarze Frau als Repräsentationsfigur einer Kultur, die auf dem Repräsentationsobjekt ihrer Unterdrückung sitzt. Direkter kann die Metaphorik an dieser Stelle nicht sein, sie wird jedoch noch weitaus komplizierter.
Das Flehen wird zum Befehl
110 Menschen, meldet das vom Guardian gestartete Projekt The Counted zur statistischen Erfassung von tödlicher Polizeigewalt am 10.2. und damit vier Tage nach Veröffentlichung von »Formation« , sind im Jahr 2016 bereits von der Polizei getötet worden.
Das letzte Update führt auch ein Opfer aus Louisiana an, wo in diesem von insgesamt vier Opfern zwei schwarz und eines weiß waren, wohingegen eine Person bisher nicht identifiziert wurde. Ist das aussagekräftig? Deutlicher machen es die Statistiken des Vorjahres: 2015 waren nach letzten Zahlen von 1140 Opfern insgesamt 303 schwarz, 578 weiß. Das wirkt in totalen Zahlen zuerst nicht auffällig. Relativ auf eine Million verteilt jedoch stehen durchschnittlich etwas mehr als 7 schwarze gegen knapp drei weiße – andere people of colour nicht eingerechnet. Noch deutlicher wird die bestürzende Diskrepanz angesichts der Gesamtverteilung: In den USA leben insgesamt etwa 42 Millionen Schwarze – das entspricht etwa 12,6% der Gesamtbevölkerung. Die Zahlen sind also eindeutig: Schwarze leben in den USA im Vergleich zu weißen Menschen mit einem astronomisch höheren Risiko, von der Polizei erschossen zu werden.»Der schwarzen Bevölkerung der USA hat noch nie etwas gehört, das sie zurückerobern könnten – ihre Kultur ausgenommen.«
Es ist erschreckend, wie viele Symbolfiguren sich zu diesen Zahlen finden lassen. Treyvon Martin und sein Hoodie sind einer davon, erschossen wurde von einem rassistisch motivierten Wannabe-Sheriff. Sein Wiedergänger tritt auch in »Formation« auf, er bringt allein durch sein Tanzen eine Reihe von weißen Polizisten dazu, die Arme hochzureißen. »Hands up, don’t shoot« lautete das Motto der Black Lives Matter-Bewegung nach der Ermordung von Michael Brown in Ferguson im August 2014. »Stop shooting us« wird daraus in »Formation«, das Flehen wird zum Befehl. Schnitt zu der auf dem Polizeiwagen liegenden Beyoncé. Das Gefährt versinkt langsam im Wasser und nimmt sie dabei mit.
Wie lässt sich das interpretieren? Soll damit gesagt werden, dass es nur eine gute Breakdance-Einlage braucht, um die Polizei zu entwaffnen? Oder wird damit nicht eher behauptet, dass selbst eben jene Polizei in der Misere versinkt? Es sind widersprüchliche Bilder, die auch mit der stilisiert positionierten Southern Belle aus der Southern Hell, mit der das Video schließt, keine Antworten liefern. Alles nur opportune Ästhetik, die Nicki Minajs hypersexualisierten Feminismus einerseits und Kendrick Lamars referenzreichen Polit-Rap aufgreift und wortwörtlich ins Stadion bringt?
Jein. Die Frage lautet weder, ob Beyoncé etwas grundlegend Neues schafft, noch wie viel eigentlich hinter der Inszenierung steht. Es ist der Akt der Inszenierung selbst, der das größte politische Zeichen setzt.
Beyoncés »Formation« ist mehr als reine Selbstdarstellung, es ist eine Gegendarstellung. Sie konfrontiert das weiße Publikum mit allen möglichen Klischees: Die vom Schicksal unberührte Frau aus New Orleans, die Southern Belle und deren Southern Gothic-Pendent, die twerkende Puffmutti, die cruisende Urbanite, die tanzende Athletin und den uniformierten R’n’B-Star aus den VHS-Archiven der neunziger Jahre. Ohne Ton betrachtet ist es ein sonnenverbranntes Fegefeuer der Eitelkeiten, keine Frage. Mit allerdings ergeben sich ganz andere Bilder.
Mit erhobener Faust tanzen
»What if we loved Black people as much as Black culture?«, fragte die Schauspielerin Amandla Stenberg vor gut einem Jahr in einem YouTube-Video Beyoncé greift das auf, inszeniert ein Kabinett aus schwarzen, weiblichen Klischees und spricht darüber eine als Drohung zu verstehende Selbstaussage aus: »I slay«. Wenn ihr unsere Kultur liebt, sollt ihr sie bekommen, heißt das.
Ihr bewundert unseren Swag schon seit Langem – aber seid ihr auch bereit, endlich den Preis dafür zu zahlen? Denn wenn ihr uns nicht liebt und weiterhin absaufen lasst, uns sogar erschießt, dann werden wir uns wehren. Das zusammen mit einer Choreographie inklusive Black Panthers-Gruß anlässlich des 50. Geburtstages der Bewegung – 50 Jahre, in denen sich offensichtlich wenig getan hat – beim medienwirksamsten Sport-Event des Jahres zu bringen, macht es umso stärker. Hier tanzen wir für eure Unterhaltung, bedeutet es, zugleich jedoch recken wir die Faust in die Höhe.»Es ist der Akt der Inszenierung selbst, mit dem »Formation« das größte politische Zeichen setzt.«
Natürlich hat Beyoncé gut reden: Sie ist anders als schwarze Südstaatlerinnen. Sie kommt aus einer Mittelschichtsfamilie und ist mittlerweile so unfassbar reich, dass sie vielleicht mit den Produktionskosten des »Formation«-Videos halb New Orleans hätte aufkaufen können. Sie kann sich zu einem »Black Bill Gates« stilisieren, weil sie selbst noch als schwarze Südstaatlerin noch privilegiert genug dafür ist. Das ist eines der zwei elementaren Logikfehlern, die »Formation« augenscheinlich prägen: Dass Beyoncé nicht ohne Weiteres für alle anderen schwarzen Frauen sprechen kann und dass sie versucht, der weißen Mehrheitsgesellschaft mit deren eigener Ideologie Angst einzujagen.
Der Kollege Kunze hat insofern recht, als dass »Formation« Scheiße mit Scheiße bekämpfen möchte. Die Frage ist allerdings, warum. Es ist einfach, in Beyoncé die erfolgsverwöhnte reiche Frau zu sehen, die den weißen Status Quo nur deshalb überhaupt in Frage stellen kann, weil sie so weit gekommen ist, dass selbst die Weißen ihr zuhören. Auch ist richtig, dass die neoliberale Kampfrhetorik des American Dream, die auch Beyoncé fährt, automatisch auf ein System der Unterdrückung hinsteuert. Das darf nicht vergessen werden: Es gibt mehr als eine Minderheit in den USA, sie alle werden marginalisiert und ausgebeutet, sind potenzielle Zielscheiben für noch mehr strukturelle Gewalt.
Es ist jedoch falsch, den von Beyoncé provokativ vorgeführten Materialismus als Versuch zu werten, etwas zurückzuerobern. Der schwarzen Bevölkerung der USA hat noch nie etwas gehört, das sie zurückerobern könnten – ihre Kultur ausgenommen. Sie befindet sich in einem Kampf, der immer schon ungerecht war. Von den Unterdrückten Empathie oder Zurückhaltung einzufordern, würde deshalb an Hohn grenzen. Alles, worauf indes »Formation« hinauswill, ist Empathie für die Unterdrückten. Nur wird das nicht mehr als Bitte formuliert, sondern als Befehl: »Stop shooting us«. Dazu hat Beyoncé, dazu hat die schwarze Bevölkerung der USA jegliches Recht. Das sollte, nein, darf ihr niemand absprechen.
Obwohl sich wohl kaum Sorgen darum machen muss, bei einem Spaziergang durch die Nachbarschaft erschossen zu werden, passierte Treyvon Martin genau das. Statisch gesehen passiert das schwarzen Menschen leider häufig, viel häufiger als weißen. »Stop shooting us« ist ein Befehl, im Grunde aber nichts weiter als ein kategorischer Imperativ, der selbstverständlich sein sollte.
Kapitulation – oder Untergang
Indem sie diese ebenso bildgewaltig und wortgewaltig in vielen ihrer Facetten – von der hot sauce bis zu Givenchy – inszeniert, erinnert Beyoncé an den schwarzen Beitrag zur Kultur der USA, die ohne diesen um so vieles ärmer wäre. Ihre vermeintliche Selbstdarstellung stellt exakt das dar: Der Reichtum, von dem ich spreche, ist auch eurer. Weil ich mich für euch auf dem Auto räkele, für euch twerke und singe.
Nur spricht das Video von »Formation« breitenwirksamer als vieles vor ihm aus, dass die Einseitigkeit dieser Situation, in der Schwarze tanzen und Weiße zugucken, ein Ende haben muss. Mit den bedeutungsschweren letzten Bildern von »Formation« entwirft Beyoncé dafür zwei mögliche Zukunftsszenarien: Entweder ergebt ihr euch friedlich unserer Kultur und hört auf, uns zu erschießen, oder aber wir alle – Unterdrücker wie Unterdrückte – saufen gemeinsam im rassismusverseuchten Brackwasser von New Orleans ab.»Beyoncé setzt sich dem male gaze aus – und bestimmt dann die Regeln für den post-koitalen Fressflash.«

Das macht Beyoncé nicht zur Heldin. Das zu behaupten, wäre zu eindimensional. Das Wunderschöne an »Formation« ist aber, wie mehrdimensional es in seiner Gesamtheit, Super-Bowl-Performance eingeschlossen, ist. Aus der Beyoncé, die sich konfrontativ vor einen grell strahlenden FEMINIST-Banner stellt, sind viele Beyoncés geworden – mit Afro, mit Braids, mit hot sauce und Givenchy. Beyoncés, die sich gleichzeitig dem begehrenden male gaze aussetzen, wie sie die Regeln für den post-koitalen Fressflash setzen. Die ihre Jackson Five nostrils in die Kamera erheben und dann mit dem Arsch wackeln.
Mit »Formation« bietet Beyoncé der schwarzen Kultur, für die sie stellvertretend vor einer größtmöglichen Öffentlichkeit spricht, zwar nicht ausreichend, immerhin doch aber genügend Identifikationsfläche. Und der weißen Mehrheitsgesellschaft die Stirn und prächtige Unterhaltung zugleich. Das ist als letztes Friedensangebot einer mit vollem Kalkül hochstilisierten Southern Belle zu verstehen, die in der letzten Einstellung des Videos erwartungsvoll in die Kamera blickt. Die Antwort auf diese Herausforderung sollte möglichst schnell kommen.