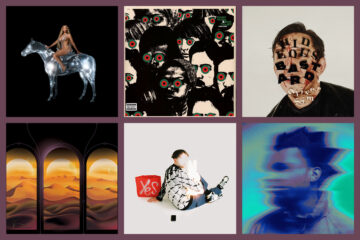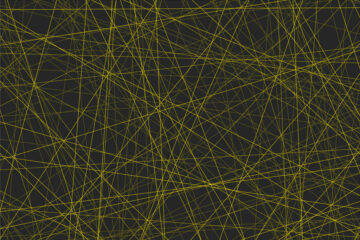Traurig, was in den trüben Gewässern unserer Zeit Wellen der Begeisterung schlagen kann. Beyoncé spricht sich im Song »Formation«, dem dazugehörigen Video und ihrem Auftritt in der Halbzeit des Super Bowls für Ermächtigung aus; Ermächtigung der afroamerikanischen Bevölkerung – und Ermächtigung der Frau.
Dass das prima ist: keine Frage. Black Panther-Referenzen während des weltweiten TV-Events schlechthin zu bringen, einen Song nur für Afroamerikaner zu machen und gleichzeitig White America aufzufordern, das sich so gerne der schwarzen Kultur bedient, diese dann bitte schon auch als Ganzes anzunehmen und mitsamt Afro, corn bread, Jackson 5 nostrils etc. zu schätzen, ist richtig, ist wichtig.
Aber es ist kein Wunder, dass Beyoncé sich gerade jetzt politisiert. Jüngst hat Nicki Minaj ihr vorgemacht, dass es nicht mehr zwangsweise unpopulär ist, sich den Term »Feministin« auf die Fahne zu schreiben (zum Glück). Gleichzeitig hat Kendrick Lamar vorgefühlt, wie weit man mit politischer Meinung im Pop gehen kann, ohne sich selbst zu marginalisieren. Das Feld ist geräumt; das Risiko, an Popularität einzubüßen, lange nicht mehr so groß wie noch vor Jahren. Jetzt, wo es die Revolution vielleicht immerhin auf YouTube schafft, hat Beyoncé ihr erstes provokantes Video veröffentlicht.
»Stop shooting us« steht da auf einer Wand. Davor Beyoncé, die macht, was sie immer gemacht hat: sich perfekt in Szene setzen. Im Kontext der seit jeher optimal inszenierten Pop-Maschine Beyoncé ist dieser Slogan nicht mehr als ein kleine Kante, die ihre Designer der makellosen corporate identity hinzugefügt haben.
Schüchterne Symbole einer Vorzeige-Kapitalistin
Toll, dass Beyoncé ihre riesige Bekanntheit nutzt, um überhaupt mal etwas zu sagen. Schwach, wie wenig sie sagt. Schrecklich, wie rückständig aber vor allem wir sind, am anderen Ende der Leitung, für die das Gesagte noch so große Besonderheit besitzt.
Was sagt sie überhaupt? Sie zeigt über Symbole, wie die Politik der Weißen die Schwarzen in New Orleans erst hat ertrinken lassen, um die Überlebenden danach einfach zu vergessen. Black Lives Matter, sagt sie. Leider ist das einem Großteil einer dummen, rassistischen Welt immer noch nicht klar – und deshalb ist es wichtig, es immer wieder zu betonen. Aber begnügen wir uns jetzt wirklich damit? Ist das ein Grund, Beyoncé zur Pop-Prophetin zu erheben?
»Formation« pikst doch höchstens ein bisschen, tut nicht wirklich weh; das wagt sich doch nur mit dem kleinen Zehen aus den Fängen des Systems, das sie bezahlt. Und nicht nur dass, im Endeffekt ruft der Text im Verlauf sogar dazu auf, genau dieses System noch zu füttern.
CITI: »Wenn Chance nutzen weiterhin bedeutet, die Beste, Schönste, Tollste zu werden, werden wir nie damit aufhören, uns zu erschießen.«:### »You can be the next black Bill Gates in the making«. Damit will sie natürlich denjenigen Mut machen, die in einer beschissenen Gesellschaft immer noch die beschissensten Karten haben. Und das beste, was dabei rauskommen kann, ist Reichtum und Macht? Na toll. Auch du hast die Chance die Beste, die Reichste, die Mächtigste zu werden. Natürlich brauchen wir Chancengleichheit, natürlich war es ein qualvoller Weg bis die USA (immerhin) ihren schwarzen Präsidenten hatten.
Aber, was wollen wir in Zukunft aus unseren Chancen machen?
Wenn »Chance nutzen« weiterhin bedeutet, die Beste, die Schönste, die Tollste zu werden, werden wir nie damit aufhören, uns zu erschießen. Nie damit aufhören, uns im Kreis zu drehen. Es ist eine Krankheit, Menschen über Superlative zu beschreiben; ein Geschwür, das unter alle dem wuchert, dass Beyoncé hier anprangert; der Motor für Neid und Missgunst, die Schere, die die Möglichkeit von Einheit zerschneidet, die Motivation für Mord und Totschlag.
»Formation« tut nichts dafür, dieses zu heilen. Eher im Gegenteil.
»I dream it, I work hard, I grind ‚til I own it« heißt es da, »get what’s mine (take what’s mine), I’m a star (I’m a star)«. Das ist nichts als eine weitere Umschreibung des amerikanischen Traums, dieser ekligen Arbeits- und Ausbeutungsethik, in der der pursuit of happiness längst zum pursuit of success geworden ist.
Auch Beyoncé betont: Ich bin reich, mächtig und sexy und du kannst das auch schaffen. Alles gut gemeint. Weil viel zu vielen immer noch die Chance verwehrt wird, das auch sein zu können. Aber wann fangen wir an uns zu fragen, was wir außerdem sein könnten? Außer reich, mächtig und sexy. Solange wir bestreben, von jedem Attribut den Superlativ zu erreichen, solange werden wir uns weiterhin gegenseitig verletzen.
Der amerikanische Traum, so wie er hier ausgelegt und vorgelebt wird, beinhaltet vor allem die Missachtung eines ganz wunderbaren Gebots: »Die Freiheit des Einzelnen hört dort auf, wo die Freiheit des Anderen beginnt.«
So erschießen wir uns weiterhin gegenseitig
Noch einmal: Wir können froh sein, dass ein Popstar dieses Kalibers wenigstens mal wieder das Maul aufmacht. Aber zufrieden sein, wie weit ihr Blick geht, können wir nicht.
Am Ende dreht es sich auch um »…,Swag«. Was verändert weniger die Gesellschaft als swag? Nichts. Vor black consciousness ist »Formation« vor allem Selbstdarstellung. Der Stinkefinger nicht mehr als ein bisschen edginess im Sexappeal, ein bisschen Aufholen zu Rihanna, die doch auf so laszive Art keine Ficks gibt und so ihre Fans gewinnt. Es geht mit fortschreitender Dauer von »Formation« auch nur um das Ego, wie es in jedem erfolgreichen Ami-R&B nur um Ego geht. Und um Geld. Das sind nicht die Ideen, die dazu beitragen werden, dass endlich niemand mehr erschossen wird. Sie sind das Fundament am Ursprung von allem Beschissenen (neben der Angst).»Oft führt ausgleichende Gerechtigkeit eben nicht zu einem Ausgleich, sondern zu einer Spirale aus Ungerechtigkeit.«
Darüberhinaus geht es in »Formation« darum, stolz auf seine Herkunft sein zu dürfen. Ein Gefühl, das den Afroamerikanern viel zu lange mit Ketten und Peitschen verwehrt wurde, und das auch heute noch ständig bedroht wird. Es muss zurückerobert werden. Diese Forderung bringt »Formation« kraftvoll auf den Punkt – und das ist gut so.
In zweiter Instanz aber fehlt dem Song der Weitblick.
Wann fangen wir an – die Rezipienten und/oder der nächste große Pop-Star – einen Schritt weiter zu denken? Sich gegen Missstände zu stellen, das ist die eine Sache, sie am Ursprung anzupacken, das ist die andere. Sich zu empören, »lass mich das sein, was ich bin« ist dringend notwendig (ob es jetzt um Hautfarbe, Geschlecht oder sonst was geht) – wirklich revolutionär wäre es aber, im nächsten Atemzug zu sagen: Egal, was ich bin, wo ich bin, ich werde dich einladen, dass auch du sein darfst, was du bist.
Auch, wenn es noch tausend Jahre dauern sollte, warum nicht jetzt schon fragen: Stolz und Herkunft, wozu? Was passiert, wenn man beides in Verbindung zuhauf empfindet, sieht man ja gerade in Europa. Beziehungsweise hat man immer überall gesehen. Zu was führt schon Stolz? Zu einem Selbstbewusstsein, dass die äußere Bestätigung braucht. Ein gärendes, giftiges Konstrukt; wenn es nicht gefüttert wird, schlägt es in Hass um.
Wir über-identifizieren uns mit Dingen, über die wir keine Kontrolle haben. Die Kontrolle aber wollen wir. Also imaginieren wir sie uns einfach. Wenn wir aber merken, dass wir sie nicht haben, schmerzt es uns, verletzt es uns; wir suchen Schuldige, machen uns besser, stärker und schöner; danach kämpfen wir, damit uns so etwas nicht mehr passiert. Dieses Verhalten wird nicht dazu beitragen, dass niemand mehr erschossen wird.
Selbst, wenn sie sich für ihre Verhältnisse weit nach vorne lehnt, ist Beyoncé mit ihrem Song noch rückständig. Wir sind alle rückständig, solange wir in Stolz denken, in Herkunft und Rasse. Das steckt so viel Abgrenzungsgebaren drin, soviel krampfhafte Selbstdefinition. Um diese zu bewahren, diese zu verteidigen, töten wir.
Mit Scheiße auf Scheiße zu schmeißen, macht den Haufen auch nicht kleiner.
Wenn er mich gut fickt, dann führe ich ihn eventuell ins Red Lobster aus. Beyoncé dreht das ekelhafte Macho-Verhalten einiger vieler Männer um und zeigt: Wir Frauen können das genauso. ###CITI: »Selbst, wenn sie sich für ihre Verhältnisse weit nach vorne lehnt, ist Beyoncé mit ihrem Song noch rückständig.«:### Alles fair – und komplett kontraproduktiv. Denn oft führt ausgleichende Gerechtigkeit eben nicht zu einem Ausgleich, sondern zu einer Spirale aus Ungerechtigkeit. So hält man das Riesenrad der Scheiße nicht an, so montiert man ihm einen weiteren Wagen.
Pop braucht halt steile Thesen, um Pop bleiben zu können. Ohne Ambivalenz, ohne Einfühlungsvermögen wird er so immer nur kurzfristig etwas verändern, langfristig mit seiner selbstverliebten Zunge aber nur die Spirale einschmieren und früher oder später wieder am Arsch der Dinge ankommen.

Mit »Formation« liefert Pop weiterhin nur Parolen, kein universelles Verständnis. So baut er keine Brücken, sondern weitere Grenzen. So befeuert er nur ein Gedankengut, das in gut und schlecht, schwarz und weiß, Frau und Mann unterscheidet und dann nicht selbst weiter denkt. So errichtet er Pole.
Man würde ja hoffen, dass zwischen den Polen die goldene Mitte erstrahlt. Aber nicht mit uns. Stattdessen klafft zwischen ihnen die Kluft immer größer, tobt zwischen ihnen der Krieg. Wir können ja weiterhin davon träumen, der nächste Bill Gates in the making zu sein.
Aber wenn das der Traum ist, den träumen wir wollen, werden wir auch weiterhin Menschen erschießen.
–––––––––––
Vielleicht kann zwischen zwei Seiten doch etwas Gutes entstehen? Hier geht’s zur Gegendarstellung