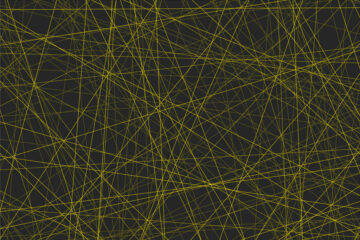Es ist das eine, die erste Europa-Tournee mit mittelgroßen Clubshows auszuverkaufen. Etwas anderes ist es, diese Clubs auf über 40°C hochzukochen und vom gesamten Publikum bei jeder Zeile assistiert zu werden. An einem dieser typischen grauen Berlinabende gelingt Abra in der Kantine am Berghain aber genau das. Sie wird selbst dann noch bejubelt, als sie für rund vier Minuten zu einem Song tanzt, der nicht einmal ihr eigener ist. Sie muss nicht einmal singen, um volle Begeisterung zu ernten. Abras Erfolg ist eng an den des atlantischen Labels Awful gebunden. Er kann aber nicht allein darauf reduziert werden. Mit zwei Alben im Gepäck und zahlreichen Kollaborationen mit diversen Awful-Acts ist sie eine der interessantesten Figuren aus einer Szene, die sich sowohl der Logik der Musikindustrie entzieht, sowie sie sich nicht auf einen Sound reduzieren lässt. Von energetischen House-Beats bis zu dem, was sie selbst als »Fairy Trap« bezeichnet, lässt Abra nahtlos Genres ineinander fließen, die sonst nur separat voneinander existieren. Wir trafen sie vor ihrem Konzert in Berlin, um mit ihr über eine Jugend als Außenseiterin fernab von Rap-Musik und ihre andere Familie zu sprechen, die sie in ihren späten Collegejahren kennenlernte: Awful.
Was ich zuerst gerne wissen würde: Wie kommt jemand, die mit christlicher und Folk-Musik…
Abra: … du hast deine Hausaufgaben gemacht, geil! (lacht)
Wart nur ab! Wie kommt jemand, die mit christlicher und Folk-Musik aufgewachsen ist dazu, Trap-Songs mit der Akustik-Gitarre nachzuspielen?
Abra: (lacht) Als ich jünger war, fühlte ich mich ausgeschlossen. Ich lernte in London das Sprechen, Laufen und Singen. Dann kam ich in die Staaten und alle waren ganz anders drauf. Das war okay, aber sie akzeptierten mich nicht wirklich. Das klingt jetzt sehr berechnend, aber sie nahmen mich nicht wirklich auf und ich fühlte mich missverstanden. Die anderen Kids lachten mich aus, weil ich Outkast oder Ludacris nicht kannte. Das war in Atlanta, eines der Epizentren von Rap und Hip Hop, und allen ging es nur um Rap, den ich mir nicht mal anhören durfte.
Du durftest dir keinen Rap anhören?
Abra: Meine Eltern haben mich kein MTV oder BET schauen lassen. Ich wurde richtiggehend aus der Popkultur verbannt und damit von all denen, die damit etwas am Hut hatten. Ich erinnere mich noch an den ersten Song, den ich damals gehört habe: »Saturday« von Ludacris. Das hat so einen Spaß gemacht, dass ich nur noch so etwas hören wollte! Ich habe dieses kleine Radio gewonnen, das ich mir nachts ins Bett mitgenommen habe. Wenn meine Eltern schliefen, habe ich damit über Kopfhörer Musik gehört. So konnte ich all diesen Leuten entgegenkommen – wir trafen uns irgendwie in der Mitte. Es war so etwas wie eine soziale Währung.
Ich wurde besessen davon. Ich liebe Bassmusik, ich liebe Drums, die Gefühle dabei, wie es dich zum Tanzen bringt… Es ist so energetisch und weil ich ein energetischer Mensch bin, ging ich total darin auf. Als ich dann Gitarre lernte, brachte ich mir das vor allem darum bei, die Songs anderer nachzuspielen. Aber ich hörte mir auch diese ganzen Rap-Songs an und dachte: »Da sind so viele Melodien drin, sie werden nur eben gerappt.« Also coverte ich Ludacris‘ »You’s A Hoe« und solchen Kram. Dafür bekam ich viel positives Feedback, was mein Selbstvertrauen aufbaute. Es machte mich zu einem Teil von etwas.»Nichts gegen das Christentum, aber die Musik ist echt whack.«
Abra
Welche Musik war besonders wichtig für dich? Wenn du von christlicher Musik sprichst, meinst du damit Gospel, traditionelle europäische Kirchenmusik…?
Abra: Wir haben nie Gospel gehört. Meine Eltern hörten sich zeitgenössische christliche Musik an, Praise And Worship -Kram. Echt, nichts gegen das Christentum, aber die Musik ist wirklich whack. Es war so eine Art Alternative Rock, aber auch nicht wirklich Rock. Es gefiel mir überhaupt nicht, immerhin aber habe ich so gelernt zu harmonisieren. Meine Mutter mochte Folk, sie hörte ständig The Mamas & The Papas und The Beatles und solches Zeug. Bevor mein Vater heiratete, war er ein ziemlich wilder Bursche, dann aber wurde er errettet, änderte sein Leben und hört mittlerweile nur noch Smooth Jazz. Sade lief ständig im Radio, Kenny G, Kenny Loggins, sowas. Ich habe den Geschmack von meinem Vater und das Können von meiner Mutter. Ich denke mal, dass mein Sound daher kommt.
Interessierst du dich für House? Das erste Mal, als ich »Roses« hörte, musste ich an Robert Owens denken.
Abra: Ich mag den alten Kram, sowas wie »Let The Music Play« von Shannon. (singt) Freestyle House aus den neunziger Jahren. (singt »Summertime, Summertime« von Nocera) Ich verliebe mich ständig in solche Musik.
Du hast diese Musik aber erst entdeckt, als du zurück nach Atlanta kamst. Wie lange hast du in Großbritannien gelebt?
Abra: Das weiß ich nicht mehr, aber ich muss bei unserer Rückkehr so acht oder neun Jahre alt gewesen sein.
Abra: Das tut es, aber das passierte erst gegen Ende meiner Collegezeit. Meine gesamte Pubertät über fühlte ich mich als Außenseiterin. Nachdem ich mit der Schule fertig war, war ich der Überzeugung, niemals irgendwo dazuzugehören und ein einsamer Wolf zu sein. Dann vergrub ich mich im Internet. Ich machte mein eigenes Ding, und plötzlich gingen die Leute total drauf ab. Ich machte etwas und es war mir egal, ob irgendjemand es gut fand. Das zog andere an, die genauso drauf waren und Andersartige nicht ausschlossen. So fing ich an, es zu genießen und mittlerweile liebe ich Atlanta. Sie lieben mich dafür, was ich aus mir gemacht habe, und ich liebe sie dafür, mich zu akzeptieren.
Du sprichst von der Awful-Posse, richtig?
Abra: Ja. Ich hatte College-Freundschaften, aber nicht viele. Fünf vielleicht, und diese Leute wollten nur feiern. Da fehlte jede Substanz. Ich hatte im College vielleicht zwei substanzielle Freundschaften. Dann traf ich Awful und sie boten mir den Kontext, in dem ich existieren kann. Als ich Awful traf, kam alles zusammen und ich fühlte mich zum ersten Mal wie ein richtiger Mensch.
Was macht Awful als Label so besonders?
Abra: Wir sind ein Kollektiv von outcasts. Ich will damit nicht sagen, dass alle dieselben Erfahrungen hatten wie ich, aber viele von ihnen sind einfach anders drauf. Sind sind art kids, die auch mal richtig aufdrehen. Wir sind nerds, die Animes gucken oder Bücher über Mythologie lesen und trotzdem Future mögen.
Wo würdest du Awful in der Musikszene von Atlanta einordnen? In Europa wird die Stadt gerne als riesiger Stripclub betrachtet, in dem alle auf Kodein oder E sind.
Abra: Awful ist ein bisschen das schwarze Schaf der Stadt. Nicht in dem Sinne, dass niemand uns mögen würde. Es dauerte aber eine Weile, bis wir akzeptiert wurden, weil wir so viel positive Resonanz bekamen. Weil wir uns nicht dem unterordneten, was alle uns sagten und wir trotzdem dafür anerkannt wurden. Wir sind die schwarzen Schafe, aber die Leute gehen trotzdem auf uns ab.
Father sagte in einem Interview, Awful sei »radikal«. Natürlich kannst du nicht für ihn sprechen, würdest du das aber unterschreiben? Und wenn ja, was macht Awful so radikal?
Abra: Ja, würde ich definitiv. Wir machen alles selbst. Lord Narf kann ein ganzes Projekt auf die Beine stellen und Ethereal produziert und mixt es im Anschluss. Oder Lui Diamonds macht einen Track und Archibald Slim springt dazu.
Außerdem sind wir ein von schwarzen Mensch geführtes Unternehmen. Das ist ziemlich außergewöhnlich. Wir haben bei keinem Label unterschrieben, wir bekommen keine Hilfe von außerhalb. Wir fragen nicht nach Geld und werden das nie tun. Wir machen genau das, was wir machen wollen. Ich denke, wir sind in dem Sinne radikal, dass wir keine Struktur haben. Nach dem Motto: »Ich habe Bock das zu machen, also machen wir das jetzt.«»Wir fragen nicht nach Geld und werden das nie tun.«
Abra
Und in ästhetischer Hinsicht?
Abra: Ja, das denke ich auch. Es gibt bei Awful viel Schockpotenzial. Wir sind wild, wir feiern hart. Wir haben das etwas heruntergeschraubt, weil wir es jetzt ernster nehmen, aber wir machen viel krassen Scheiß.
Als ich Fathers Video zu »Everybody In The Club Getting Shot« sah, fand ich das sehr interessant, im Video zu »Roses« lässt sich ein ähnlicher Kontrast zwischen Kawaii-Ästhetik und…
Abra: Light-hearted darkness.
Ja. Was reizt euch daran?
Abra: Ich weiß nicht… ich denke, wir alle haben ziemlich viel üblen Kram durchlebt, uns aber dazu entschlossen, uns nicht davon runterziehen zu lassen. Stattdessen machen etwas Spaßiges draus, das nicht allzu ernst ist. Father hat auf seinem Arm ein Tattoo von einem Skelett und macht das (deutet ein »take it easy«-Handzeichen« an) und sagt: »Das Leben ist schon okay.« Darum geht’s: Wir alle haben schlimmes Zeug erlebt, aber das ist cool. Mach einfach das Beste draus, mach Kunst draus.
Wohin soll das führen?
Abra: Wir machen einfach so weiter. Nimm zum Beispiel »Rose«. Viele der Songs drehen sich um sehr ernste, schwerwiegende Themen und du kannst trotzdem drauf tanzen. Es geht darum, dein Herz preiszugeben und anderen damit im gleichen Zug eine Freude zu bereiten.
Ihr seid allerdings eine eingeschworene Gruppe. Je bekannter das Label wird, wird es nicht auch umso schwieriger sein, das aufrecht zu erhalten?
Abra: Nein. Weil wir nicht einfach ein Label sind, sondern eine Familie. Und das meine ich nicht auf so eine schmalzige Art nach dem Motto »wir sind alle beste Freunde und hängen miteinander rum«. Wir sind im wahrsten Sinne des Wortes eine Familie. Es ist unmöglich, dass irgendjemand Awful verlässt. Es gibt Streitigkeiten bei Awful, physische Auseinandersetzungen. Situationen, in denen manche es richtig schlimm verbockt haben. Aber das ist egal, denn genauso wie bei einer Familie kannst du dich vielleicht mit deinem Bruder prügeln, er bleibt aber dein Bruder. Du kannst ihn nicht aus der Familie verbannen, ihn nicht verleugnen, weil er dich abgefuckt hat. Das ist die Art von Mentalität, nach der es bei uns läuft. Niemand wird zurückgelassen. Niemand sagt dir: »Oh, du kommst gerade nicht in die Gänge? Pech auch.« Wir werden alles dafür geben, dass alle Essen auf dem Tisch haben und sich um jeden gekümmert wird.