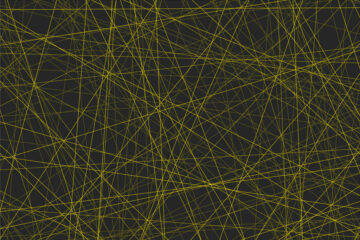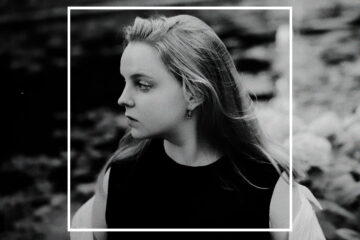»Fuck Compton!« Die 1991er Kampfansage des New Yorker MCs Tim Dogs war eher frustriert als erbaulich – und ging mehr oder minder sang- und klanglos unter. Kein Wunder: Seinerzeit war eben der kalifornische Gangsta Rap-Entwurf der Sound der Stunde. Losgelöst von der Rap-Szene der US-Ostküste setzte man in und um Los Angeles eher auf George Clinton als auf James Brown, klang nach endlos ausufernder Party und propagierte dabei ein high life in low places. Koks und Nutten inklusive. Aufgehend im American Dream, durchgesetzt mit Waffengewalt. Eine Opfer-der-Umstände-Haltung wurde ad acta gelegt, vielmehr war es angesagt, sich als Täter der Umstände zu inszenieren. Die Werte von Hip-Hops alter Schule und die geistige Haltung der Zulu Nation wurden derweil vergessen. Wenn nicht sogar negiert.
Derweil auf der gegenüberliegenden Küste, in New York City: Public Enemy sind angesagt. Sie predigen afroamerikanischen Separatismus und wütende Selbstermächtigung, vorgetragen auf Beat-Brettern, bei denen der Funk sich schon mal dem Noise unterordnet. »Wenn es deiner Frau gefällt, dann ist es noch nicht richtig«, formulierte Hank Shocklee, der maßgeblich am Sound von Public Enemy mitwirkte, rückblickend den angewandten Ansatz – im Scherz zwar, aber Ernst war es ihm damit schon.
Eine junge Generation New Yorker Rapper wollte allerdings sehr wohl den Frauen gefallen – und ihnen dabei auf Augenhöhe begegnen. Sie hielten ebenfalls die Afrozentrismus-Fahne hoch, nur wurden unter ihrer Flagge keine militanten Phrasen gedroschen. Nicht nur Rap-Chronisten wissen Bescheid: Die Rede ist vom Native Tongues Movement. Der Rap dieser Bewegung griff den Spirit der Zulu Nation auf, wollte open minded, vor allem aber positive minded sein. Einer der prominentesten Vertreter dieser lose verknüpften Crew sind A Tribe Called Quest.
A Tribe Called Quest, das sind in ihrer ursprünglichen Besetzung vier junge Männer aus St. Albans, Queens: die MCs Q-Tip, Phife Dawg, Jarobi White sowie DJ Ali Shaheed Muhammad. Als Rap-Act stachen sie von Beginn an heraus. Ihre fünf Alben, die sie in den 1990er Jahren aufgenommen haben, bereicherten die Szene mit freshen Sounds und einem ungewöhnlichen Tonfall, der einerseits die Straße im Blick hatte, seine bürgerlichen Wurzeln aber nie verleugnete. Q-Tip als besonnener Denker und Phife Dawg als unbefangener Quatschmacher bildeten das lyrische Zentrum, dessen Dynamik von seiner Gegensätzlichkeit lebte.
Beim Beat-Bauen glänzten sie derweil nicht nur durch Jazz-Eklektizismus, sondern auch dadurch, dass sie Musiker wie Ron Carter zu sich ins Studio holten. Die Worte Jazz Rap oder Acid Jazz waren damals noch gar nicht erfunden. Nicht umsonst hat sich die wöchentliche experimentelle Hip-Hop Club Night »Low End Theory«, die seit zehn Jahren in Los Angeles den Ton angibt, nach dem zweiten Album von A Tribe Called Quest benannt.
Immer noch dieselbe Dringlichkeit
Nun ist all das aber lange her. A Tribe Called Quest gibt es seit 30 Jahren, seit 18 Jahren ist aber kaum etwas passiert, wenn man mal von einem Dokumentarfilm und ihren routinierten, aber halbherzigen Festival-Engagements absieht. Dass sie mit mit »We Got It From Here … Thank You 4 Your Service« plötzlich wie aus dem Nichts aus der Versenkung zurückkehrten, ist alleine schon eine Sensation. Das Album selbst ist auch eine. Weil es deutlich mehr ist als eines dieser uninspirierten Alterswerke, mit denen sich die Stars der Vergangenheit noch mal ihre Rentenkasse aufbessern wollen. »We Got It« will keinen Status verwalten, es ist ganz und gar ein Werk der Gegenwart, das versucht, neu macht, zerstört und aufbaut. Trotzdem kratzt nicht nicht an ihrem musikalischen Vermächtnis, es rundet es zum Finale hin sogar noch mal ab. Alleine schon, weil es mit derselben Dringlichkeit nach vorn prescht, die auch ihr glorreiches Frühwerk auszeichnet.
Dringlich war ihnen dabei nicht nur die Möglichkeit, sich zwischen »Black Lives Matter« und »Make America Great Again« zu positionieren. Denn ausgerechnet der Tod redete noch ein Wörtchen über die Entstehung von »We Got It From Here … Thank You 4 Your Service« mit. ###CITI: »We Got It« prescht mit derselben Dringlichkeit nach vorn, die auch ihr glorreiches Frühwerk auszeichnet.:### Phife Dawg verstarb diesen März an den Spätfolgen seiner Diabetes – unvermittelt, aus heiterem Himmel. Was durchaus die letzte Möglichkeit sein sollte, nochmals seine gemeinsame Sicht auf den Status Quo zu formulieren, war plötzlich gefährdet, in seinen Grundfesten erschüttert. Q-Tip und Co. brachten die begonnene Arbeit (die ersten Aufnahmen für das Album entstanden bereits 1995) einem Ende, das sowohl ihnen als Band als auch Phife Dawg als Freund ein würdiges Denkmal setzt. Verklärung gibt es nämlich nicht, eher Lösungsansätze – so gut sie eben sein können angesichts kompromissloser Tragik.
Mitgeschrieben hat Phife Dawg an fast allen der 16 Songs – zu hören ist er noch auf sieben. Seine Lücken versuchen nun andere zu schließen, eben Q-Tip und Jarobi selbst, tatkräftig im Studio unterstützt von alten Weggefährten wie Busta Rhymes und Consequence sowie von prominenten Befürwortern wie Kanye West Kendrick Lamar Talib Kweli Jack White und, ja, tatsächlich, Elton John.
Ein ungetrübter Blick nach vorne versus Missstände und letzte Instanzen also, alles über live eingespielte Instrumente: Ist die Qualität von »We got it from Here … Thank You 4 Your Service« einem alten Erfolgsrezept zu verdanken? Nicht ganz: Man merkt dem Album deutlich an, was seine Urheber bewegt – und das ist weit mehr als der unerwartete Tod eines geliebten Menschen. Die Zeit ging auch sonst nicht spurlos an A Tribe Called Quest vorüber. Anstatt sich aber auszuruhen und aus dem Ohrensessel alte Formeln zu beschwören, zeigen sich Q-Tip und Co. recht angriffslustig in ihrer Besonnenheit. In die Take-it-easy-Haltung der Vergangenheit hat sich Zynismus geschlichen, Paranoia sich mit den positive vibrations gepaart, einhergehend mit geschickt gekleideter Agitation, weswegen einige das Album gar als erste Protestplatte der Ära Trump betrachten – was gar nicht mal so abwegig ist.
Daneben gibt’s aber noch eine weitere Sache, mit der A Tribe Called Quest herausstechen: Sie sind nicht nur sie selbst, sondern immer auch Band geblieben, ein Gefüge mit klaren Konturen, Ecken und Kanten – etwas, dass es, obwohl oft kopiert, kein zweites Mal gibt. Insofern sind sie und ihr neues, finales Album ein Beleg dafür, dass man im heutigen Rap Game auch ohne kurzlebige Hypes und aktuell angesagte Hit-Produzenten Furore machen kann. Es ist auch in einer hyperindividuellen Welt noch möglich, unverkennbar einzigartig zu sein. Dass es für diesen Eindruck mitunter Leute aus der alten Garde bedarf: Geschenkt. Danke dafür!