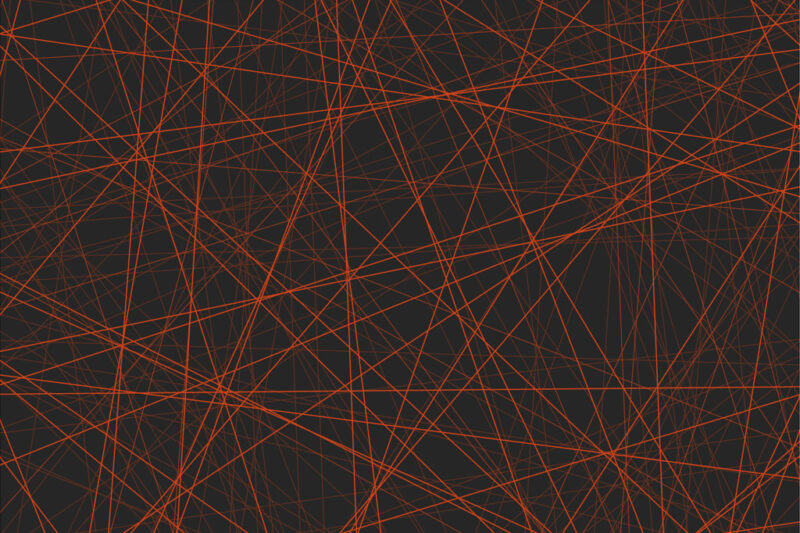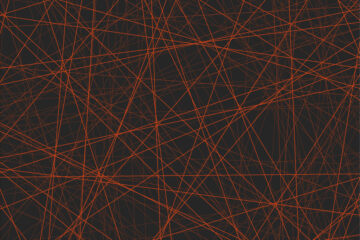Als am 15. Juli 2012 ein 4:12 Minuten langes Video auf YouTube hochgeladen wurde, waren dessen globalpolitische Konsequenzen noch nicht abzusehen. Der britische Premier David Cameron und der POTUS Barack Obama sollten wenige Monate später nachahmen, was darin zu sehen war. Selbst der Generalsekretär der Vereinten Nationen, Ban Ki-moon, bezeichnete es als eine »Kraft für den Weltfrieden«. 4:12 Minuten, die die Welt zusammenzubringen sollten. Oder?
Natürlich kam es anders. 2017 drohte Obamas Nachfolger per Twitter dem Nachbarland des südkoreanischen Rappers Psy mit dem Atomkrieg. »Gangnam Style« hatte nicht eingehalten, was Ki-moon angesichts des viralen Erfolgs seines Videos prophezeite: Der Weltfrieden ist seit seiner Veröffentlichung in noch weitere Ferne gerückt.
»Gangnam Style« wurde deswegen zu einem so einen flächendeckenden Erfolg, weil kaum jemand außerhalb Südkoreas überhaupt verstand, worum es dem pummeligen Sänger ging. ###CITI: Wo endet die ehrbare Absicht, wo beginnt die stückchenhafte Ausbeutung?:### Eigentlich war der Song ursprünglich nichts weiter als eine Persiflage auf das Gebaren der südkoreanischen Oberschicht im gleichnamigen Distrikt der Landeshauptstadt Seoul. Die Übersetzungen und Kontextualisierungsversuche aber hinkten der Verbreitung des Videos hinterher. Dessen Erfolg entzog sich den üblichen Erklärungsmustern ebenso wie den herkömmlichen Abläufen der westlichen Musikindustrie.
Social Media machte möglich, was kein hundertköpfiges Marketing-Team hätte forcieren können: Dass aus der regional beschränkten Satire ein internationaler Smash-Hit wurde. Obwohl die Welt mit dem Erfolg des Videos ein Stück weiter zusammenzurücken schien, wurden die Differenzen dafür umso offensichtlicher: Im globalen Norden beziehungsweise Westen wurde das Video unkritisch gedeutet. Tenor: Die haben da alle ein Rad ab.
Psys Geschichte scheint zuerst nicht so ungewöhnlich. Haben wir dasselbe nicht schon zuvor mit algerischen Raï-Sängern in den Neunzigern erlebt? Oder mit dem Syrer Omar Souleyman
Der Unterschied zwischen den beiden Erfolgsgeschichten von Psy und Souleyman liegt zum einen in der Form der Verbreitung: Souleyman hatte westliche Gatekeeper wie das Label Sublime Frequencies, die ihm unter die Arme griffen. Psy aber wurde ohne viel Hilfestellung zum Viralhit. Ein paar Jahre zuvor wäre das schier unmöglich gewesen. Aber die Welt war ein bisschen enger zusammen gerückt, das heißt noch dichter miteinander vernetzt. Von YouTube ging es für »Gangnam Style« auf Facebook, Twitter, tumblr, und so weiter – around the world, around the world.
Vorsprung durch Technik
Die Idee, dass Technologie die Welt näher zusammenbringt, ist ungefähr so alt wie die Erfindung der Schrift. Mit jeder neuen Entwicklung aber wird diese Idee erneut ans Tageslicht befördert, ausgeweidet und irgendwann vergessen. Bis das nächste Medium die Weltgemeinschaft zu revolutionieren verspricht.
Anfang der Achtziger, dem Jahrzehnt des Samplers, setzen sich Jon Hassell und Brian Eno das Ziel, eine komplett neue Musik zu erschaffen.


Womöglich herrscht eine Nachfrage nach Utopie. Denn was ist eine Fourth World, wenn nicht genau das: Ein Nicht-Ort, der außerhalb aller Konzepte von Raum (und bisweilen auch der Zeit) zu existieren scheint? Der die Kulturen zugleich umfasst und vereint, im friedlich-künstlerischen Miteinander?

Mit der Idee einer Fourth World Music gingen aber von Anfang an schon Fourth World Problems einher. So hehr die Ziele von Hassell und Eno auch gewesen sein mögen, ihre Motivation scheint sich nicht wesentlich von ordinärer Kolonialisationslogik zu unterscheiden: Einerseits verorteten sich die beiden als Vertreter einer »ersten« Welt auf der Spitze des zivilisatorischen Siegertreppchens, anstatt diese Hierarchie selbst zu hinterfragen. Die Drei-plus-eins-Gleichung des Fourth World-Konzepts basiert ausdrücklich auf einem kulturellen Vorsprung durch Technik.
Andererseits legte Hassell, der laut eigener Aussage Enos Namen nur aus finanziellen Gründen mit aufs Cover aufnahm, die Grundlagen für das Verfahren, die jener mit dem Talking Heads David Byrne 1981 auf dem Album »My Life In The Bush Of Ghosts« populär machten: das Sampling. Ein wesentliches Problem am Sampling ist seinem Namen eingeschrieben. Denn ein Sample ist eben genau das: eine Stichprobe, ein kleiner Happen, die minimale Auswahl eines ganzheitlichen Bildes. Sampling kann und soll sogar keine größeren Kontexte erfahrbar machen, sondern in andere überführt werden. Problematisch wird es dann, wenn ganze Kulturen entwurzelt, in Einzelteile zerstückelt und mundgerecht zum Feierabend serviert werden. Wo endet die ehrbare Absicht, wo beginnt die stückchenhafte Ausbeutung? Anders gefragt: Wenn die Fourth World für alle sein soll, warum stehen dann wieder nur die Namen zwei weißer Männer aus wohlhabenden Industriestaaten drauf? Sieht so, hört sich so eine Utopie an? Oder vielmehr die bittere Realität?

Dort die Musik, hier das Kapital
»The early twenty-first century will be remembered as a time of great forgetting«, lautet gleich der erste Satz von Jace Claytons – besser bekannt unter seinem Pseudonym DJ /rupture – 2016 erschienenem Buch »Uproot. Travels in 21st-Century Music and Digital Culture«. Darin zeichnet Clayton in unterhaltsamen Anekdoten die Entstehung von regionalen Sounds und ihren bisweilen globalen Siegeszügen aus den letzten 17 Jahren nach. Psy im Kleinen, sozusagen.
Von Fruity Loops bis Autotune sind es vor allem technologische Errungenschaften, die das möglich machen. Eins aber wird dabei in der Tat gerne vergessen: Obwohl die Produktionsmittel für neue und aufregende Musik mittlerweile beinahe überall erhältlich sind, liegt das Kapital weiterhin in westlicher Hand.
Im Herbst 2016 kam Bewegung in die Reissue-Szene: Der Chef des jungen Labels PMG wurde beschuldigt, zuvor auf seinem Label Steinklang unter anderem das Horst-Wessel-Lied auf eine Compilation gepresst und selbst als Rasthof Dachau Musik veröffentlicht zu haben. Rechtsradikale Verbindungslinien, afrikanischer Funk: Der perfekte Skandal war geboren und recht schnell wieder vergessen.

Selbst bei fairen Deals mit den Artists kommt selten etwas in den Kulturen an, als deren Tokens sie in der Musikpresse und in der Diskussion über Musik aus der sogenannten dritten Welt herhalten müssen. Angefangen vom Presswerk über die Vertriebe hin zu den Labels: Das hinter den Kulissen kursierende Geld bleibt überwiegend bei uns, die Steuern werden zuhause gezahlt.
Das gilt auch für diejenigen, die ihr Publikum mit den besten Intentionen an die Sounds aus aller Welt heranführen müssen. Sowohl Optimo und Schulte beispielsweise profitieren von einem weiteren Trend, der sie in ihrer Gatekeeper-Funktion zu Tastemakern macht: Sie gelten weniger als DJs denn vielmehr als Selectors. ###CITI: Der Preis für die Utopie liegt darin, dass die Insel sich fast völlig von der Außenwelt abgeschottet hat.:###Der in den letzten Jahren immer häufiger verwendete Begriff, dem das niederländische Kollektiv Dekmantel ein eigenes Festival sowie eine von verschiedenen DJs betreute Compilation-Serie widmete, wird selten als Selbstzuschreibung verwendet. Weder Optimo noch Schulte inszenieren sich in der Rolle, die ihnen angetragen wird und erst recht liefern sie keine Heilsversprechen ab. Sie wollen ihr Publikum lediglich für gute Musik begeistern und sie dabei vielleicht anstubsen, sich mit derjenigen anderen Kulturen auseinanderzusetzen. Doch auch sie arbeiten damit ungewollt an einem Klischee mit, das ein 2017 kursierendes Meme persiflierte: Umrahmt von der Caption »Starter pack for white ppl who play rare African disco jams for white ppl« sind darauf von der Hornbrille über das dümmliche Hawaii-Hemd bis zum Rotary-Mixer alle Insignien zeitgenössischen Gatekeepings abgebildet.
So ehrbar es auch ist, der vermeintlich dritten Welt Tor und Tür aufstoßen zu wollen, so wird damit auch die Schwelle zwischen den Kulturen nur betont. Unterschiede anzuerkennen ist wichtig und richtig, doch die reine Kurationstätigkeit, die den Markt im Westen mit Reissues und ethnographischen Aufnahmen von überall her überflutet, räumt jungen Artists von eben dort wenig Platz ein. Wie viele Fans von malischem Funk aus den siebziger Jahren wissen eigentlich, was aktuell in den Clubs von Bamako gespielt wird? Das Dilemma erinnert ein wenig an die Schattenseite von dem, was More vor 501 Jahren in »Utopia« beschrieb: Der Preis für die Utopie liegt darin, dass die Insel sich fast völlig von der Außenwelt abgeschottet hat.
Durch die Hintertür in die Welt
Technologie kann, wie vor fünf Jahren schon Psy zeigte, an den Gatekeepern vorbei den Schlupfweg durch die Hintertür öffnen. 2017 mehr denn je. Zumal sich nicht wenige der Gatekeeper in ihrer Rolle offensichtlich nicht wohl fühlen und ihre eigene Stellung problematisieren.




Wie internationale Musik klingen kann, die sich nicht von ihren Wurzeln losgelöst hat und die eigene kulturelle Identität in ein globales Narrativ einflechtet, machten in den letzten Jahren vor allem viele Netlabels vor. Von NON Worldwide über Príncipe, Staycore und N.A.A.F.I. hin zur Partyreihe Club Chai, die sich in diesem Jahr mit einer Compilation und der Debüt-EP der Künstlerin Thoom als Label etablierte: Was da vor allem durchs Netz und somit an der konventionellen Verwertungslogik der Musikindustrie seinen Ausdruck findet, ist weniger Fourth World denn One World. Eine Welt allerdings, in der die Unterschiede nicht kaschiert, sondern produktiv genutzt werden.
Psy hatte vorgemacht, dass die angebliche westliche Welt ihren Vorsprung durch Technik bereits insofern verloren hat, als dass der Erfolg nicht mehr nur allein in ihren geregelten Bahnen möglich ist. Und die Technologie verbreitet sich derweil in die andere Richtung, wie Jace Clayton bewiesen hat. Das alles kommt der Idee einer Fourth World Music ironischer Weise näher, als diese ursprünglich gemeint war.