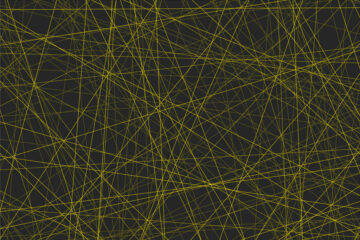»Ich wollte nie in einer verfickten Rockband sein«, sagt Thom Yorke 2000. Zehn Monate sind seit der Jahrtausendwende vergangen. Madonna steht auf Platz 1 der deutschen Charts, während der britische Sänger von Radiohead genug hat. Von Rock. Vom Musikgeschäft. Von sich selbst. Mit »Kid A« veröffentlicht die Band am 2. Oktober 2000 ein Album, das die Gitarren auf den Müllhaufen der Geschichte schmeißt, um Platz zu machen für Synthesizer und Effektgeräte. Die »größte Rockband aller Zeiten« hat keinen Bock mehr auf Rock. Und studiert Songs von Aphex Twin, um für Coldplay den Sound von Muse zu erfinden.

Kid A
Drei Jahre zuvor veröffentlichten Radiohead »OK Computer« Ihre Welttournee führte die Band aus Oxford von Glastonbury nach Los Angeles, von Tokio nach Melbourne, von einem Zustand der Entfremdung in die Leere des Nihilismus. Den Breakdown bannt Regisseur Grant Gee mit seiner Doku »Meeting People is Easy« auf Film. Er begleitet Radiohead ein Jahr um die Welt und filmt eine Gruppe, die sich selbst zerstört. Die Farben verschwinden aus den Bildern, ausgesaugt von immer selben Fragen bei Interviews, endlosen Fototerminen, der Stille nach der Show. Der Band fehlen die Worte, um ihre Starre zu erklären. Radiohead erscheint als Wrack, getarnt als Yacht, der mitten auf dem Atlantik der Sprit ausgeht.
Nach der Tour existiert Radiohead in einem Vakuum. Man spuckt in Antihaltung auf den Kapitalismus und streckt der Musikmaschinerie fünf Mittelfinger entgegen. Thom Yorke kauft alle Platten von Warp Records. Er verliert sich in den angesoffenen Sounds von Boards of Canada, stolpert über Autechre und lässt sich auf Aphex Twin ein. Eine neue Welt eröffnet sich – ohne Gitarren und ohne dem mit Nostalgie und patriarchaler Lad Culture überladenen Britpop, auf dessen Pastiche-Welle Bands wie Oasis oder Blur reiten. Es ist der Moment, in dem sich Thom Yorke von seiner eigenen Mystifikation als Sänger einer Rockband verabschiedet. Er hört eine Zukunft, die Leute wie Richard D. James in der Vergangenheit produziert haben. Eine Vergangenheit, von der die restliche Band noch nichts weiß.
Gitarrist Ed O’Brien hofft zu diesem Zeitpunkt, dass Yorke zurückfindet zu einer Zeit vor »OK Computer«, zu Gitarrenriffs und Hooks, die einem das Schmalz aus den Ohren drehen. Aber der Sänger pocht auf Rhythmen, will nichts mehr von Melodien wissen und verklickert der Band, dass sie Gitarren und Verstärker an Copycats wie Muse und Travis verchecken sollen. Wirklich happy ist damit niemand außer Yorke, aber nur der weiß, in welche Richtung er Radiohead drehen möchte. Er schreibt monatelang keine Texte, verheddert sich in gedanklichem Chaos, das sich in seiner Zerrissenheit zwischen den äußeren Erwartungen an den Klischee-Rockstar und den eigenen Vorstellungen einer Welt ohne globalisiertem Kapitalismus verliert.
Man schreibt Thom Yorke auf der Platte den Tod des Autors zu, sieht das Subjekt im Rauschen der Effektketten aufgelöst und applaudiert der Band zu einem musikgewordenen Rorschachtest, der sich aus der eigenen Entfremdung löst und die Arbeit an die Fans auslagert.
Als »Kid A« erscheint, hören die Leute Pearl Jam. Auf 150.000 Platten läuft als Intro ein Bootleg von Eddie Vedders Grungeband. Erst nach 40 Sekunden brechen die Synthesizer-Akkorde von »Everyhting In Its Right Place« durch. Fans fühlen sich im falschen Film. Wer? Was? Radiohead? Das Album springt im UK trotz des Fehlers auf die Eins und verkauft sich in den USA in der ersten Woche über 220.000 Mal, obwohl kaum jemand versteht, was auf der Platte abgeht. Thom Yorke murmelt unverständliches Dada-Gebrabbel durch Filterbänke, die Gitarren haben sich auf »National Anthem« zu einem seltenen Moshpit zusammengerauft – und überall flimmern Synthesizer, als hätten die Jungs von Autechre abgelaufene Pillen von 1993 verschluckt.
Kritiker bei Pitchfork und Rolling Stone trommeln sich gegenseitig auf die Brust und schmeißen ihre Pink Floyd-Platten aus dem Fenster, weil sie glauben, es gäbe das versteckte Potential von »Kid A« zu dekodieren. Man schreibt Thom Yorke auf der Platte den Tod des Autors zu, sieht das Subjekt im Rauschen der Effektketten aufgelöst und applaudiert der Band zu einem musikgewordenen Rorschachtest, der sich aus der eigenen Entfremdung löst und die Arbeit an die Fans auslagert. »Kid A« wolle nicht nur gehört, sondern verstanden werden – nach dem Motto: inklusive Gedanken in einer exklusiven Gesellschaft, oder: Art Rock für Soziologie-Seminare, Electronica für Intellektuelle, Jazz und Noise für geniale Dilettanten, die am sensorischen Overload der Platte eine Gedenkkerze an ihre eigene Studienzeit anzünden.
Related reviews
Radiohead
Kid A Mnesia
Thom Yorke
Anima
Radiohead
OK Computer OKNOTOK 1997-2017
Bryce Dessner/Jonny Greenwood
St. Carolyn by the Sea/Suite from »There Will Be Blood«
In ihrer Anti-Alles-Haltung nehmen sich Radiohead aus der Veröffentlichung, existieren nur als digitale Avatare und klatschen bei illegalen Downloads durch Napster in die Hände. Das passt sogar der Major-Plattenfirma, weil sich die Ablehnung der Inszenierung als ultimative Inszenierung entpuppt. Auf dem Cover prangen Eisberge wie Computerglitches auf Bildschirmschoner anno 1998. Die Realität verblasst, die Fiktion blüht in Rätseln animierter Kurzfilme und kryptischer Botschaften auf der Band-Webseite. Und weil sich Abneigung gegen verwertbaren Konsum durch konsumierte Verwertung kapitalisieren lässt, schlägt das Ding bei Leuten wie Brad Pitt ein, die in der Band »die Kafkas und Becketts unserer Generation« entdecken.
»Kid A« war die Einstiegsdroge für ausgebrannte Managerfutzis, die sich sonst lieber das Union-Jack-Gejaule von Liam Gallagher reinzogen als sich eine Sekunde mit elektronischer Musik zu beschäftigten; und es war der goldene Schuss für jene, die auf Papas Plattensammlung hängenblieben, weil seit Pink Floyd sowieso alles scheiße gewesen sei. Aphex Twin wollte mit der Platte übrigens nichts zu tun haben und nannte sie »ziemlich cheesy«. Für viele Leute ist »Kid A« trotzdem das beste Radiohead-Album aller Zeiten. Oder wie Thom Yorke sagen würde: »Fucking rock music sucks. I hate it.«