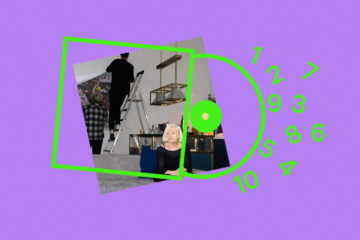Er hat mit Ghostface Killah und Kendrick Lamar zusammengearbeitet, den Soundtrack zum Marvel-Streifen »Luke Cage« geschrieben und mit Jazz Is Dead ein eigenes Label gegründet. Der US-amerikanische Musiker Adrian Younge ist das, was man gern mal mit big im Business beschreibt. Für sein neues Album »The American Negro« stellt er sich vor eine Schulklasse, die nie existiert hat, aber existieren sollte. Eine Schulklasse, in der es um Fragen der Gerechtigkeit und die Ideologie des Rassismus geht. In der man Dinge bespricht, die an am System rütteln wie Yung Hurn am Watschenbaum. Und die auf den frontalen Schock setzt. Auf dem Cover von »The American Negro« baumelt Adrian Younge am Strick – Facebook hat das Video wiederholt gelöscht. »Aber niemand hat mich gefragt, ob ich sehen möchte, wie ein Polizist George Floyd tötet«, sagt Younge. Sein Album sei eine Belehrung, eine Art Geschichtsbuch, die Weiterführung von Marvin Gayes »What’s Going On«. Warum man die Vergangenheit aus der Gegenwart bearbeiten muss, wieso man ihm dabei zuhören sollte und die Botschaft manchmal wichtiger als die Musik ist, hat Adrian Younge im Gespräch erzählt.
Siehst du dich als Künstler oder Aktivist?
Adrian Younge: Als beides! Aber lass mich die Frage mit einer Gegenfrage beantworten: Würdest du Marvin Gaye als Aktivisten bezeichnen, weil er »What’s Going On« veröffentlichte?
Ha!
Adrian Younge: Genau. Ich betrachte mich absolut als Aktivisten, denn der Hauptgrund, warum ich »The American Negro« gemacht habe, war, die Leute über Ungerechtigkeiten aufzuklären, die uns immer noch betreffen. Ich wollte kontextualisieren, warum wir immer noch mit so viel Fanatismus und Diskriminierung auf der ganzen Welt konfrontiert sind. Schließlich zeigt sich Rassismus international unterschiedlich. Jede Nation hat ihre eigenen Probleme. Aber die Probleme, die sich aus dem Rassismus ableiten, lassen sich alle auf die Sklaverei zurückverfolgen. Sklaverei kam vor Rassismus. Vor ihr gab es in der westlichen Welt natürlich eine Hierarchie, die auf Klassen basierte – es existierten Feudalismus und religiöse Doktrinen, die Menschen gegeneinander ausspielten –, aber das System war nicht so race-basiert wie heute. Erst mit dem Kapitalismus glaubten Nationen, dass es in Ordnung war, Schwarze systematisch auszugrenzen. Deshalb änderten sich die Bräuche und Gesetze, wie man Menschen aufgrund ihrer Herkunft behandelt. Kommt man als Schwarzer auf die Welt, ist das so, als ob man als Krimineller geboren wird. Während diese Prinzipien für einige Wenige eine große Menge an Einkommen schaffen, versetzen sie andere in ewige Knechtschaft. Heute sagen einige, dass es so etwas wie Rassismus nicht mehr gebe, weil die Sklaverei abgeschafft worden sei oder es eine Bürgerrechtsbewegung gegeben habe. Aber er existiert überall! Rassismus ist nur nicht mehr so schamlos wie früher.
Es ist subtiler und struktureller…
Adrian Younge: Wir betrachten ethnische Beziehungen neu, weil wir Gespräche über die Nuancen des Rassismus führen. Davor gab es nicht so viele Diskussionen über all die Ungerechtigkeiten, mit denen wir konfrontiert sind. Ich habe »The American Negro«, meinen Kurzfilm »TAN« und den Podcast »Invisible Blackness« geschaffen, um unsere Geschichte zu kontextualisieren – die Geschichte, die von unseren Nationen revidiert wurde.
Das führt mich zurück zur ersten Frage, ob du sich als Künstler oder Aktivist betrachtest. Mit »The American Negro« erkennt man einen Shift in deiner Arbeit. Sie ist frontaler, politisch aufgeladener und selbstsicherer.
Adrian Younge: Das ist das wichtigste Projekt, an dem ich je mitgewirkt habe. Die Botschaft ist viel wichtiger als die Musik. Es ist eine Belehrung über Amerika und die Welt. Ich lese viel, bin ein Wahrheitssucher – wenn du aufwächst und Dinge realisierst, wie zum Beispiel, dass es für deine Eltern schwieriger ist, dich zu erziehen, wenn du eine andere Hautfarbe hast. Man realisiert, dass diejenigen mit anderer Hautfarbe länger und häufiger inhaftiert werden als Weiße, obwohl sie das gleiche Verbrechen begangen haben. Wenn man anfängt, all diese Variablen zusammenzuzählen, erkennt man ein Rätsel, und man fängt an zu suchen, wer dieses Rätsel kontrolliert. Natürlich will man dann, dass die Leute wissen, dass race ein soziales Konstrukt ist. Es ist ein Trugschluss, dass es keine wissenschaftliche Grundlage dafür gibt. Wir kommen alle aus Afrika. Ich kann sagen, du bist Schwarz und ich kann sagen, ich bin Schwarz. Wir sind alle gleich. Wenn ich mich an die asiatische oder lateinamerikanische Community wende und »Black Power« sage, meine ich damit: »Power to the people«. Wir müssen uns ständig daran erinnern, dass wir alle gleich sind. Wir müssen uns empowern, indem wir diese Dinge sagen, damit wir uns alle als Menschen identifizieren können. Aber zuerst müssen wir Menschen an das Konzept heranführen.
Und dann?
Adrian Younge: Sobald man das Konzept verstanden hat, kann man anfangen, die Ungerechtigkeiten in der Welt zu analysieren. Man stößt auf Antworten und Gründe, warum diese Dinge passieren. Wenn man in die Geschichte zurückblickt, erkennt man, wie Mechanismen, die vor Jahrhunderten in Gang gesetzt wurden, uns immer noch verdrängen. Unsere Regierungen bemühen sich schließlich nur zögerlich um Gerechtigkeit. Es passiert etwas, aber nur schrittweise. Wir müssen schreien, um gehört zu werden. Als die George-Floyd-Proteste stattfanden, waren das die größten Proteste der Welt. Das hatten wir noch nie!
Und sie breiteten sich auf die ganze Welt aus.
Adrian Younge: Ja, wie die Menschen für eine gemeinsame Sache zusammenkamen, war schön zu sehen. Es war nicht nur ein Protest der Schwarzen, es war ein Protest aller Menschen, weil die Leute sahen, dass Menschen aufgrund ihrer Hautfarbe an den Rand gedrängt werden; dass es für sie schwieriger ist, zu leben, und dass es nicht fair für uns alle ist, wenn das passiert. »The American Negro«, der Podcast (»Invisible Blackness«) und der Film (»TAN«) sollen Teil des Zeitgeistes werden. Ich will, dass sie Teil der Bewegung sind. Das Traurige ist: Ich weiß nicht, wann die Diskriminierung aufhören wird – wenn überhaupt.
»Es gab bisher einfach noch kein Album, das eine lehrende Haltung gegen soziale Ungleichheiten im Zusammenhang mit race einnahm. Mit »The American Negro« wollte ich genau das tun.«
Adrian Younge
Dein Ansatz, in der Geschichte zurückzugehen und sie zu bearbeiten, ist ein Anfang. Ich habe das Album als Bestandsaufnahme der Gegenwart mit einem Fokus auf die Vergangenheit gehört.
Adrian Younge: Ich stimme dir zu. Die Remanenz des Rassismus lässt eine ideologische Struktur gären, in der Bilder den Wert Schwarzer Menschen untergraben. Wenn man uns im Fernsehen als Kriminelle darstellt; wenn man uns in Filmen als Schwächlinge sieht, wird das zu unserer wahrgenommenen Identität. Wie wichtig das Selbstwertgefühl und die Identität für die Art und Weise ist, wie Menschen leben, darf man aber nicht vergessen. Wenn Menschen also erst gar nicht an sich selbst glauben können, warum sollten sie es überhaupt versuchen? Wenn die Gesellschaft ihnen sagt, dass sie wegen ihrer Hautfarbe nicht gut genug seien, können die meisten normalen Menschen nicht über diese Hürde springen. Sie können nicht darüber hinwegsehen, wie andere Menschen sie sehen. Es gibt so viele Gründe, warum diese institutionalisierte Form der Diskriminierung so furchtbar ist. Und doch stelle ich mir immer wieder die Frage: Warum müssen wir uns dem stellen? Ich habe zwei Töchter, und ich muss ihnen ständig sagen, wie besonders sie sind. Gleichzeitig bin ich auch Sohn. Meine Mutter erzählte mir mal, wie viel Angst sie hatte, wenn ich als Kind das Haus verließ. Nur weil ich Schwarz bin! Sie wollte nicht, dass ich auf die falsche Seite des Gesetzes gerate – dabei war ich nicht das Kind, das oft Schwierigkeiten verursachte. Heute gehe ich jeden Tag an die Arbeit, trage einen Anzug – trotzdem könnte ich jederzeit behandelt werden wie ein Gangster, der wie ein Crip oder Blood aussieht.
Ich erinnere mich an die Geschichte, als Miles Davis Opfer von Polizeigewalt wurde. Es war 1959, er hatte gerade »A Kind of Blue« veröffentlicht und nichts Falsches getan. Trotzdem verprügelte ihn die Polizei. Das ist nur ein Vorfall von Polizeibrutalität gegen People Of Colour aus der Vergangenheit, aber er zeigt, wie wenig sich geändert hat.
Adrian Younge: Es ist nicht so, dass sich in all der Zeit nichts geändert hätte. Es gab Orte im Süden, die vor 50 Jahren noch immer segregiert waren, obwohl es nicht mehr erlaubt gewesen war. Es gab immer noch Orte, an denen wir nicht in einen Bus steigen konnten. Das passiert heute nicht mehr im gleichen Maße. Die Frage ist aber, ob sich die Mentalität geändert hat. Nur weil man nicht schamlos darüber spricht, wie rassistisch man ist, heißt das nicht, dass man nicht immer noch ein Rassist ist. Man kann ein guter Mensch sein, aber unbewusst rassistische Handlungen begehen. Man kann einfach einem Brauch oder einer Tradition folgen, ohne zu merken, dass das, was man tut, rassistisch ist. Und man kann eine Person nur wegen ihrer Hautfarbe verurteilen und nicht erkennen, dass es rassistisch ist, weil es in der Umgebung, in der man sozialisiert wurde, akzeptiert wurde. Trotzdem: Unwissenheit schützt nicht vor Strafe. Wenn du hättest wissen müssen, dass deine Handlung falsch war, bist du dafür zur Verantwortung zu ziehen. Deshalb versuche ich die Leute zu unterrichten, was Rassismus ist, damit sie sich selbst reflektieren und fragen können, ob sie rassistische Handlungen begehen.
Du sprichst davon, Menschen zu unterrichten. Dafür müssen sie zuerst mal zuhören. Was lässt dich glauben, dass sie auf dich hören?
Adrian Younge: Es gibt eine Menge Leute, die bereit sind, zuzuhören. Und es gibt eine Menge, die überhaupt nichts davon hören wollen. Das sind die Leute, die ich für kompromisslos halte – es ist die Unnachgiebigkeit der Blinden. Ihre Unwilligkeit, zuzuhören oder andere Meinungen außerhalb ihrer eigenen zu hören, sind sektiererische Ansichten. Das kann man nicht ändern, das ist einfach so. Aber die Mehrzahl der Menschen ist gut. Zumindest glaube ich das.
Was bringt Sie dazu, das zu glauben?
Adrian Younge: In Amerika wird uns beigebracht, dass Abraham Lincoln ein Retter der Schwarzen war; dass er derjenige war, der die versklavten Menschen befreit hat. Dass Abraham Lincoln Schwarze nicht als gleichberechtigte Menschen ansah, bringt man uns aber nicht bei. Dabei muss man sich nur seine Reden ansehen. Er bezeichnete uns – vor allem bei Reden im Süden – als Ungleiche. Außerdem diskutierte er darüber, Schwarze Menschen zurück nach Afrika zu schicken. Dass er die versklavten Menschen in den USA befreite, war nur ein militärischer Schachzug. Der Norden kämpfte gegen den Süden, dessen System und Wirtschaft auf der Sklaverei basierte. Um den Norden und den Süden zu vereinen, emanzipierte Lincoln die Versklavten im Zuge einer militärischen Taktik. Gleichzeitig wollte Lincoln nicht, dass Schwarze im Krieg dienen, weil sie keine Waffen besitzen durften. Darüber redet in der Schule niemand! Wenn man aber anfängt, den Leuten beizubringen, dass unsere Verfassung geschaffen wurde, um weiße besitzende Männer in Amerika zu schützen – weder Frauen noch Schwarze – dann fängt man an zu verstehen, was es bedeutet, die Regeln des Gesetzes zu befolgen. Regeln, die von weißen Männern geschaffen wurden, um sich selbst zu schützen. Wenn man das weiß, beginnt man die Zusammenhänge zu verstehen, wie die Gesetze heute geschrieben werden. Diese Substanzen des Gesetzes sind dem Naturrecht so diametral entgegengesetzt… Du siehst, es gibt viele Gründe, warum Bildung den Durchschnittsmenschen zu einem Zuhörer machen kann.
Das ist der Grund, warum du über die rassistische Vergangenheit der USA nicht in Metaphern sprichst, sondern ganz direkt. Die Musik ist nicht die Grundlage für die Worte, sondern es ist genau umgekehrt.
Adrian Younge: Ich werde immer Musik machen, aber wenn ich ein Album hätte machen können, das das Leben von Menschen verändert, gibt es kein wichtigeres Kunstwerk als dieses. Man muss das analog zu Marvin Gayes »What’s Going On« verstehen. Ich liebe seine restlichen Alben, aber keine andere Platte von ihm ist – basierend auf ihrer egalitären Botschaft – so wichtig wie »What’s Going On«. Ich wollte meine eigene Version davon haben und sie weiter vorantreiben, indem ich über das Leben und die Gerechtigkeit von einer Professoren-Perspektive spreche, anstatt nur als Künstler aufzutreten. Dadurch will ich die Geschichte aufbrechen, um den Leuten ein Dokument zu übergeben, mit dem sie sich über die Überreste des Rassismus unterrichten können.
Daher auch die Spoken-Word-Einlagen zwischen den eigentlichen Tracks?
Adrian Younge: Auf jeden Fall.
In einem anderen Interview sagtest du, dass es wichtig sei, die Leute unbewusst dazu zu bringen, die Botschaft zu hören. Im Falle des Albums, das die Leute eher frontal anspricht, ist dieser Ansatz nicht ganz zutreffend, oder?
Adrian Younge: Ich weiß nicht, auf welches Interview du dich beziehst, aber ich wollte die Leute nicht in die Botschaft hineintricksen. Als Musiker erschaffe ich Rätsel, die die Leute lösen sollen…
Das Interview erschien bei Vulture.
Adrian Younge: Was hab ich da gesagt?
Im Originalzitat sagst du: »Wenn man die Leute sozusagen in die Botschaft hineintrickst, hat man gewonnen«.
Adrian Younge: Das bezog sich wahrscheinlich darauf, dass die Botschaft wichtiger als die Musik sei. Lass es mich anders probieren: Ich könnte schöne Musik machen. Das sage ich ganz bescheiden, aber ist gar nicht so schwer. In dem Moment, in dem man eine Botschaft mit hineinbringt, wird es schon schwieriger. Man verleitet die Leute dazu, sich die Botschaft anzuhören. Manche Leute mögen meine Musik. Sie hören sie sich an, ohne eine Botschaft zu erwarten, bekommen sie aber, ohne gefragt zu werden. Das meinte ich wohl, als ich sagte, man müsse Menschen in die Botschaft hineintricksen.
«Es ist eine Platte über Menschenrechte und über die Tatsache, dass einige von uns nicht gleich behandelt werden. Wenn wir alle zusammenkommen und erkennen, was passiert, dient Empathie immer als Treibstoff für positive Ergebnisse.«
Adrian Younge
Du stupst die Leute in die Botschaft hinein.
Adrian Younge: Eine weiße Journalistin sagte mir, dass sie zuerst nicht gedacht habe, dass dieses Album etwas für sie sei. Nachdem sie es ein paar Mal gehört hatte, habe sie aber erkannt, dass es das war. Schließlich habe ich kein Album für Schwarze gemacht, es ist eine Platte über Menschenrechte und über die Tatsache, dass einige von uns nicht gleich behandelt werden. Wenn wir alle zusammenkommen und erkennen, was passiert, dient Empathie immer als Treibstoff für positive Ergebnisse. Wenn wir diese Botschaft des Bewusst-Werdens verbreiten, können wir versuchen, so viel Fanatismus wie möglich auszulöschen. Deshalb müssen wir uns die Vergangenheit anschauen. Nur so kann man sehen, dass wir einen guten Job machen, weil wir besser werden. Wir sind aber noch nicht am Ziel.
Soll heißen: Man darf nie aufhören, die Menschen aufzuklären.
Adrian Younge: Ja, es gibt so viel, das man nicht weiß. Über sich, sein eigenes Land oder andere Länder – eben weil man davon nie etwas in der Schule gehört hat. Wenn ich zum Beispiel nach Brasilien fahre, treffe ich dort auf Menschen, die dieselbe Hautfarbe haben wie ich, aber sie werden nicht als Schwarze angesehen, selbst wenn sie Schwarze Vorfahren haben. In den USA ist das ganz anders. Es gab schon immer die Ein-Prozent-Regel. Hatte man ein Prozent Schwarze Vorfahren, ist man Schwarzer. No matter what. Es ist interessant zu sehen, wie dieses falsche Konzept von race die Art und Weise verändert, wie Menschen in der Gesellschaft anerkannt werden. Es ist willkürlich. Brasilianer nennen sich einfach Brasilianer, aber das verdeckt den wirklichen Rassismus, der darunter liegt.
Das erinnert mich an das Zitat, das James Baldwin gesagt hat: »Weiß ist keine Farbe, es ist eine Einstellung, während Schwarz ein Zustand ist.«
Adrian Younge: James Baldwin hatte großen Einfluss auf mich. Die Tiefe, in die er vorstieß, als er über Rassenbeziehungen sprach, verehre ich. Marvin Gayes »What’s Going On« geht in eine ähnliche Richtung, aber es grub nie so tief wie Baldwin. Das meine ich gar nicht herablassend. Es gab bisher einfach noch kein Album, das eine lehrende Haltung gegen soziale Ungleichheiten im Zusammenhang mit race einnahm. Mit »The American Negro« wollte ich genau das tun.
Als ich das Album hörte, habe ich das Konzept der Platte durch die Linse eines Jura-Professors wahrgenommen. Ich hatte das Gefühl, dass du Beweise und Quellen der Vergangenheit gesammelt hast, um damit die Gegenwart anzuklagen.
Adrian Younge: Ich habe einen Fall zusammengetragen, richtig. Das war eine schwierige Entscheidung, weil man die Musik für den politischen Kontext opfert. Aber ich musste es tun. Ansonsten wäre ich nicht in der Lage, mit dir darüber zu sprechen. Und du wärst nicht in der Lage, mit anderen Menschen darüber zu sprechen. Jeder, der sich das Album anhört, ist ein bisschen schlauer. Das meine ich nicht arrogant. Es sind Dinge auf dem Album, die nicht einmal ich wusste, bevor ich die Platte machte.
Es ist eine Art sonisches Geschichtsbuch.
Adrian Younge: Das ist es, danke! Ich möchte, dass jüngere Leute es hören, wenn sie aufwachsen, um zu verstehen, dass zwölf der ersten 18 Präsidenten der Vereinigten Staaten von Amerika Sklavenhalter waren. Damit verbringen wir hier keine Zeit in der Grundschule Aber was wäre, wenn wir es täten?
Das mag eine blöde Frage sein, aber was würde sich ändern?
Adrian Younge: Jüngere Menschen würden besser aufgeklärt werden, wenn es um soziale Fragen geht, die mit Rasse zu tun haben. Ich gebe dir ein Beispiel: Dadurch, dass wir vier Jahre Trump als Präsidenten hatten, sind viele der Probleme in unserer Gesellschaft offensichtlich geworden. Seine Präsidentschaft hat aber ein Phänomen geschaffen. Junge Leute drehen Videos, in denen sie ihre Eltern über deren Rassismus aufklären. Das hat es davor nicht gegeben. Es liegt daran, dass junge Menschen sich gegenseitig über das Konzept aufklären, dass Black Lives Matter. Sie argumentieren nicht, dass Schwarze Leben wichtiger sind als andere. Sie argumentierten, dass Schwarze Leben genauso wichtig sind wie alle anderen! Wenn Kinder diese komplizierte Botschaft verstehen, werden sie aufwachsen und als Erwachsene nicht mehr der rassistischen Ideologie verfallen.
Was wahrscheinlich die am meisten erfüllende Konsequenz des Albums ist.
Adrian Younge: Es macht den Leuten klar, dass es so etwas wie race nicht gibt. Die Botschaft ist: Behandelt alle Menschen gleich.